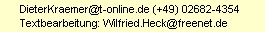| 29.04.2007 ___> Fortsetzung im Datum voraus - hier
klicken |
 Lieber
Wasserspeicher als Stromspeicher. Mit zunehmendem Ausbau der
riesigen Anlagen zur Gewinnung für Strom aus Solar- und
Windkraftanlagen in Deutschlands Fluren und Feldern erkennt deren Lobby
die damit einhergehenden Probleme für eine gesicherte und
unterbrechungsfreie Stomversorgung und verstärkt daher die
Propaganda
für Stromspeicher. Derartige, mit viel Aufwand zu errichtende und
zu betreibende Anlagen sind jedoch nicht der Energieerzeugung sondern
dem
Energieverbrauch zuzuordnen. Sollen sie bei einem Wirkungsgrad von ca.
70%
mit Strom aus regenerativen Quellen geladen werden, dann
heißt das im Klartext, daß 30% der gewonnenen erneuerbaren
Energien in nutzlose Wärme umgewandelt und zudem noch mehr
entsprechende Gerätschaften in Umwelt und Natur errichtet werden
müssen - um den bei Stromspeicherung entstehenden Verlust zu
decken. Eine Milchmädchenrechnung. Aber gut für das
Geschäft mit Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien zum
Aufstellen in der freien Landschaft. Der
Verbraucher muß den zusätzlichen Aufwand dafür
über seine Stromrechnung begleichen, hat aber keinen Nutzen davon.
Nicht nur Energiespeicher, alle Speicherformen, arbeiten stets
verlustreich. Lieber
Wasserspeicher als Stromspeicher. Mit zunehmendem Ausbau der
riesigen Anlagen zur Gewinnung für Strom aus Solar- und
Windkraftanlagen in Deutschlands Fluren und Feldern erkennt deren Lobby
die damit einhergehenden Probleme für eine gesicherte und
unterbrechungsfreie Stomversorgung und verstärkt daher die
Propaganda
für Stromspeicher. Derartige, mit viel Aufwand zu errichtende und
zu betreibende Anlagen sind jedoch nicht der Energieerzeugung sondern
dem
Energieverbrauch zuzuordnen. Sollen sie bei einem Wirkungsgrad von ca.
70%
mit Strom aus regenerativen Quellen geladen werden, dann
heißt das im Klartext, daß 30% der gewonnenen erneuerbaren
Energien in nutzlose Wärme umgewandelt und zudem noch mehr
entsprechende Gerätschaften in Umwelt und Natur errichtet werden
müssen - um den bei Stromspeicherung entstehenden Verlust zu
decken. Eine Milchmädchenrechnung. Aber gut für das
Geschäft mit Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien zum
Aufstellen in der freien Landschaft. Der
Verbraucher muß den zusätzlichen Aufwand dafür
über seine Stromrechnung begleichen, hat aber keinen Nutzen davon.
Nicht nur Energiespeicher, alle Speicherformen, arbeiten stets
verlustreich.
Wer daher, wie der Aacherner
Solarenergie-Förderverein
Deutschland e.V. (SFV) in seinem Rundbrief vom 03.04.2007 meint, sich
einen Stromspeicher in den Keller stellen zu können, handelt
prinzipiell so verschwenderisch wie Abermillionen Haushalte mit
ihren nicht bedarfsgerecht genutzten Tiefkühltruhen, bei denen die
Ware
vielfach eher dem Verderb als dem Verzehr entgegensieht.
Warenspeicherung macht wirklichen Sinn in Notzeiten, weniger in
wirtschaftlich normalen Zeiten. Industrielle Produktionsmethoden haben
dies
längst erkannt und - insbesondere aus Effizienzgründen -
die sogenannte
just-in-time-Herstellung von Waren eingeführt. Lagerung von Ware,
sowie Lagerhäuser mögen zu bestimmten Zeiten ihren Sinn
haben,
bedeuten aber in jedem Fall Energiebedarf. Ohne Energieaufwand wird
keine Lagerung (Speicherung) funktionieren. Um diesen Aufwand zu
vermeiden, ist es für effizienzbewußte Ingenieure stets das
Ziel, den jeweils
gewünschten Bedarf nur
dann zu befriedigen, wenn er anfällt. Diese Denkweise scheint wohl
Vergangenheit zu sein.
Zwecks Rechtfertigung der Speichermentalität benutzt der energiewendeorientierte
Solarenergie-Förderverein in Aachen in seiner
Argumentation einen sonnigen und gleichzeitig windigen
Frühlingstag mit einem Überschuß an Wind- und
Solarstrom. Aber was ist an anderen Tagen des Jahres? Man bedenke
allein die letzten drei Wochen mit schönen Frühlingstagen, an
denen selbst in Norddeutschland die Windräder vielfach standen
oder vor sich hin dödelten. Auch wenn alle Dächer, Fassaden
und Lärmschutzwände mit
Solarzellen versehen wären und sich überall moderne
Windräder abseits von Siedlungen und Naturschutzgebieten drehen
würden, gäbe es allenfalls einen temporären, ungeplanten
Stromüberschuß zum Laden eines Elektrizitätsspeichers,
aber
noch lange keinen allgemeinen Stromüberfluß. Wie schon
gesagt, Energiespeicher zählen zu der Kategorie der
Stromverbraucher, deren Bedarf ebenso zeitgemäß zu
befriedigen ist, wie jener von Kunden aus Haushalten, Gewerbe,
Industrie und Verwaltung. Ein leerer Energiespeicher in Phasen, wenn
keine Sonne scheint, wie nachts, oder auch an neblig trüben Tagen,
da kein Wind weht, dürfte keine Seltenheit werden. Zu dem
eingeschränkten Nutzen der wind-solaren Stromerzeugung käme
jener von verlustreichen Energiespeichern hinzu. Doch der
wesentliche Gesichtspunkt ist dann aber der gewaltige, mit einem Ausbau
von
Stromspeichern (in häuslichen Kellern!) einhergehende Energie- und
Ressourcenverbrauch. Sollen
regenerativ arbeitende Stromspeicher ihren Sinn erfüllen, dann
müssen sie ebenso wie
konventionelle Kraftwerke bedarfsgerecht bereit stehen. Das werden sie
genau so wenig tun, wie die regenerative Erzeugung selber. Diesen
Aspekt will der SFV verschleiern. Häusliche Energiespeicher werden
nicht anders betrieben werden, wie Tiefkühltruhen - sie werden
stets am Netz sein und den Grundlastbedarf steigern. Ein gefundenes
Fressen für die sonst geschmähte Kernenergienutzung.
Herkömmliche Pumpspeicheranlagen werden jeweils gezielt
gefüllt und geleert. Gefüllt werden sie, wenn konventionelle
Kraftwerke nicht ausgelastet sind, meist während
'Nachstromtälern' und zu Zeiten von
Spitzenlastentnahmen übern Tag wieder geleert.
Dieses Procedere ist einer planbaren Regelmäßigkeit
unterworfen (dem stetig wiederkehrenden Tag-Nacht-Rhytmus), welche es
ermöglicht, Kraftwerke stets effizienzoptimiert zu steuern und
betreiben. Stromspeicher, welche mit rein regenerativen Energien
betrieben werden, wären gleichsam wie andere Verbraucher von der
Unvereinbarkeit einer Bedarfsbefriedigung mit der Erzeugung
betroffen. Mit ihnen könnte auch der Fall auftreten, daß sie
gerade dann voll sind, wenn das regenerative Angebot günstig ist
bzw. ebenso umgekehrt, daß sie leer sind und weder Wind weht noch
die Sonne scheint. Es ist eben ein Unterschied, ob man eine gesicherte
Stromversorgung der Natur überläßt oder ob sie vom
Mensch technisch optimal gesteuert wird.
Stromüberfluß,
mit dem der SFV argumentiert, ist etwas
anderes als ein momentaner
Stromüberschuß. Daß man mit Wind- und
Solarstromanlagen keinen Stromüberfluß produzieren kann,
beweisen sie längst anhand ihrer mangelhaften jährlichen
Auslastungen (Wind deutschlandweit bei 17% und Sonne bei 10%) seit
Jahren selber. Ein Ausgleich von natürlich bedingten
Energiemangelsituationen mittels Masseninstallationen in der Landschaft
und auf allen Dächern dürfte wohl zu den diversen abstrusen
Argumenten der Energiewendetheorie des SFV gehören. Zu
Nachtzeiten, wenn die Sonne nicht scheint - produzieren selbst eine
Million
Solarplatten auch nicht mehr Strom als eine einzige.
Auszug aus der
SFV-Energiemail vom 03.04.2007 und
Kommentierung
|
Was tun, wenn die Sonne nicht scheint und
der Wind nicht weht?
Diese Frage gehört zu den häufigsten
Fragen in der Diskussion um 100% Erneuerbare Energien und verlangt
deshalb eine geduldige Antwort: Um die eingefahrenen Gedankengänge
aufzubrechen, drehen wir einmal die Fragestellung um. Was machen wir,
wenn die Sonne scheint und der Wind stetig weht? Ein
sonniger Frühlingstag, der Wind weht frisch. Alle Dächer,
Fassaden und Lärmschutzwände sind mit Solarzellen versehen
und abseits der Siedlungen und der Naturschutzgebiete drehen sich
überall moderne Windräder. Solar- und Windstrom sind im
Überfluß vorhanden - etwa zehnmal so viel wie aktuell
verbraucht werden kann. Unsere heutigen starren Energiestrukturen sehen
auch diesen Überschuß im Angebot als ein Problem an.
Was
heißt
hier aktuell? Etwa zu Spitzenlastzeiten? Tagsüber
zur Mittagszeit, wenn die Sonne am stärksten scheint, sollen
Solarstromanlagen doch dem Ersatz von konventionellen Kraftwerken
dienen. Können sie neben dem anstehenden hohen Verbrauch dann auch
noch leere Stromspeicher füllen? Wieviel energie- landschafts- und
ressourcenfressende Wind- und Solaranlagen wären zusätzlich
dafür notwendig? Und führt dies wirklich zu einer
Substitution von konventionellen Kraftwerken? Und was machen wir
zur
Mittagszeit an vielen normalen Tagen des Jahres, an denen der Wind nur
schwach säuselt, tausende Windräder vor sich hin dödeln
und Wolken den
Himmel bedeckt halten? Wie muß die Kapazität der
Stromspeicher bemessen
sein, um solch unkalkulierbare Flauten zu überbrücken?
Doch es gibt eine intelligente Lösung,
die sowohl mit Überschuß- als auch mit Mangelproblemen
fertig werden kann, die Marktwirtschaft. Wenn eine Ware knapp wird,
steigt der Preis, wenn sie im Überfluß vorhanden ist, sinkt
der Preis, geht schließlich auf Null zurück. Die Ware wird
verschenkt, und unter Umständen gibt es sogar noch eine
Prämie für denjenigen, der sie abnimmt.
Das Verschenken
einer Ware mag für regenerative Energien gelten,
welche dann
produziert, wenn sie nicht benötigt zu werden. Dänemark
verschenkt z.B. seinen teuer produzierten Windstrom in das Verbundnetz,
weil zu stürmischen Zeiten das Land selber keine Verwendung dafür
findet. Denn trotz
momentanen
Überschuß kann das mit vielen Heizkraftwerken ausgestattete
Land
kein einziges Wärmekraftwerk zwecks 'Enegiewende'
außer Betrieb nehmen.
Was würden Sie denn machen, wenn es immer wieder mal Strom umsonst
gibt, und wenn an anderen Tagen viel Geld für Strom bezahlt werden
muß? Na klar, Sie würden sich einen Stromspeicher in den
Keller
stellen. Wenn Strom billig ist, würden Sie den Speicher
füllen und wenn Strom teuer ist, würden Sie Strom aus Ihrem
Speicher mit hohem Gewinn verkaufen.
Diese Idee
unterstellt jedem Stromverbraucher neben der
Zockermentalität eines Aktionärs auch die Funktion eines
Stromhändlers - hat im Sinne mit der in Anspruch genommenen
Marktwirtschaft aber wenig zu tun. Denn schlußfolgernd
ließe sich dieser Gedankengang auch auf andere Produkte
des täglichen Lebens ausweiten.
Zugleich stellt sich die Frage, wieso der SFV meint,
marktwirtschaftlich
argumentieren zu müssen, wo er doch selber seine Existenz auf dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) - fern jeder Martwirtschaft - gründet.
Sagen Sie nicht, so etwas ginge
nicht. So etwas hat es bereits 1949 im Jahr der Berliner Blockade
gegeben. Da wurde ganz Westberlin bei Stromknappheit aus
Bleiakkumulatoren versorgt, die der Energieversorger (die BEWAG) in
riesigen Mengen aufgestellt hatte. Und heute gibt es effektivere
Speicher als Bleibatterien.
Was sind das heute
für Speicher - und um wieviel effektiver arbeiten
sie? Benötigen wir, wie damals die Berliner, eine
Notstromversorgung oder eine stets verfügbare, gesicherte
Stromlieferung. Wer Maßnahmen aus
Berliner Notzeiten nach dem Zweiten Weltkrieg heranzieht, um damit die
gegenwärtige Industrie- und Wirtschaftskultur samt unserer darauf
bauenden Lebensqualität zu vergleichen, hat
wirtschaftspolitisch nicht alle Tassen im Schrank. Man stelle sich den
damaligen Zustand ausgeweitet auf ganz Deutschland vor!
.
Man kann das ganze Verfahren voll
automatisieren. Dazu braucht man eine intelligente Steuerung. Die
entscheidet aufgrund der im Internet abrufbaren öffentlichen
Ertragsvorhersage und des jeweils geltenden Strompreises, ob Ihr
Speicher aufgeladen werden soll oder ob Strom aus dem Speicher ins Netz
abgegeben wird. Und wenn Sie nicht selber einen Speicher betreiben
wollen, dann beteiligen Sie sich finanziell an einer
Großspeicher-AG. Die Speichertechnik wird einen ungeahnten
Aufschwung nehmen.
Auf die
SFV-Präsentation dieser elektrotechnisch und
wirtschaftlich
praktikablen 'intelligenten' Steuerung warten Ingenieure der
elektrischen Energieversorgung seit Jahren. Mit dem ungeahnten
Aufschwung mag der SFV dagegen richtig liegen - ähnlich wie mit
jenem der in der Gesamtheit
hochsubventionierten EE-Branche.
Stromspeicher wären dann ein hinzukommender Bestandteil der
Subventionen für eine EE-Stromgewinnung, deren wesentliche
Existenz sich aus dem Potential der Geldwirtschaft eines wohlhabenden
Industrielandes, aber nicht aus dem der solaren Energieeinstrahlung
rekrutiert.
Die häufig gestellte Frage nach der Stromversorgung in den
seltenen (wieso selten?)
Tagen, an denen weder die Sonne scheint noch der Wind weht, beantworten
wir also so: Erstens gibt es dann eine Grundversorgung aus Wasserkraft,
Geothermie und Biogas.
Ob diese
Grundversorgung ausreicht, sollte erst einmal bewiesen
werden. Die Wasserkraft, seit Beginn der Elektrifizierung für die
Grundlastdeckung genutzt, ist längst ausgereizt und reicht mit
ihren Pumpspeicherwerken allenfalls zur Spitzenlaststeuerung.
Ersichtlich ist ihr geringes Potential bereits daran, daß sie
bereits von der ebenfalls nicht ausreichenden Windkraftnutzung an Land
eingeholt wurde. Geothermie, die Energie aus dem Erdinnern, ist ein
fabelhaftes und aus menschlicher Sicht unerschöpfliches und
hochenergetisches Potential, derzeit aber noch in weiter Ferne bzw.
Tiefe. Was die Bioenergienutzung anbelangt, da sind wir derzeit im
großen Umfang dabei,
heranwachsende Biomassen zunehmend energetisch zu verwerten
(verbrennen) und dauerhaft unbrauchbar zu machen anstatt sie für
die Humusbildung zwecks Förderung des Grünwachstums zu
recyclen.
Auch Solarzellen liefern - selbst an trüben Tagen - tagsüber
einen kleinen Anteil. Zusätzlich können noch die Kraftwerke
mit speicherbarer Biomasse eingesetzt werden. Schließlich wird
aus Millionen dezentraler privater und öffentlicher Speicher Strom
ins Netz eingespeist. Um das erreichen zu können, brauchen wir
allerdings eine Strukturänderung: Das System der starren
Strompreise ist überholt. Der Strompreis muß bis auf die
Verbraucherebene jederzeit von Angebot und Nachfrage bestimmt werden.
Das elektrische
Stromnetz läßt sich weder mit starren noch mit dynamischen
Strompreisen steuern, sondern nur mittels steuerbare und abrufbare
Leistungen von jederzeit verfügbaren Erzeugern (Kraftwerken). Je
mehr Anbieter
von EE-Strom ihre Ware in diesem System ertragreich unters Volk bringen
wollen, desto
höher muß bei gleichbleibendem Verbrauch der Preis für
die Kilowattstunde werden - ganz einfach deshalb, weil der Aufwand
dafür in die Höhe getrieben wird. Ansonsten könnte die
steigende Zahl von Solarstromanbieter wirtschaftlich nicht
existieren. Das ist der eigentliche Grund für den Bestand des EEG
- aber auch gleichzeitig für die Ineffizienz der
EE-Stromgewinnung. Man stelle sich folgende Fallkonstruktion vor: Es
gibt eine Million Anbieter welche aufgrund einer begrenzten Anzahl von
Verbrauchern auch nur eine begrenzte Strommenge verkaufen können.
Sollen alle EE-Anbieter befriedigt werden - so will es das Gesetz -
dann
müssen auch alle bezahlt werden. Verkauft darauf hin der
herkömmliche Versorger wegen der sich einstellenden
Strommengenverschiebung weniger Strom, dann hebt er eben den Preis
für seine Kilowattstunde an. Denn das herkömmliche Kraftwerk
muß ja weiterhin in Betrieb bleiben. Ergo: steigt mit der Anzahl
der
gesetzlich privilegierten EE-Anbieter auch deren Angebot, dann
müssen sie eben, umgelegt auf
alle Verbraucher, bei mengenmäßig gleichbleibendem Verbrauch
mittels steigender Strompreise entlöhnt werden.
Marktwirtschaftlich eine Obskurität!
PS. Auch auf den Stromverbrauch wird sich die Preisregelung auswirken.
An windigen Wintertagen, wenn Strom nahezu "verschenkt" wird, lohnt es
sich sogar, den häuslichen Warmwasserspeicher elektrisch
aufzuheizen. Oder an sonnigen Sommertagen zur Mittagszeit - wenn
Photovoltaikstrom im Überfluß vorhanden sein wird, wird man
die Tiefkühltruhe ganz bewußt auf die kältest
zulässige
Tieftemperatur herunterkühlen, um in den nächsten Stunden auf
Strom zur Kühlung verzichten zu können. Und
Elektroautofahrer, die nicht täglich fahren müssen, werden
ihre Autobatterien bewußt an Tagen des Stromüberangebots
aufladen.
Diese
feinsinnige Argumentation ist generell nicht von der Hand zu weisen,
wird aber in eine andere Richtung führen - hin zur
vollelektrischen Hausheizung- bzw. -klimatisierung. Denn Verbraucher
wollen nicht nur im Winter ihr Warmwassergerät heizen und auch
nicht nur im Sommer die Kühlmaschinen laufen lassen, sondern das
gesamte Jahr über. Interessant ist
hingegen, daß Warmwasserspeicher und Tiefkühltruhen, welche
zu den sonst geschmähten 'Standby-Verbrauchern' zählen, nun
plöztlich als Argument für eine EE-Stromversorgung
herangezogen
werden. Grundsätzlich ist der Energiebedarf eines beheizten Hauses
an windigen Tagen höher als bei Flauten. Wind kühlt als
bewegte Luft die Außenflächen von Häusern stärker
als stehende Luft und führt so zu einem Energiemehrverbrauch. Rein
energetisch betrachtet ist Windstrom sogar die ideale Beigabe für
die vollelektrische Hausheizung. Solarstrom desgleichen für die
vollelektrische Klimatisierung eines Gebäudes. Was aber nur im
Zusammenspiel mit konventionellen Kraftwerken funktioniert - aber nicht
als Ersatz für sie. Getreu
dem Motto 'weg vom Öl' - hin zur Kohle-
und/oder Kernenergie mit einem stets verfügbaren Leistungsangebot.
Und Elektroautofahrer werden sich an ihren Bedürfnissen
orientieren
und das Fahrzeug wohl hauptsächlich am Tag benutzen und den Akku
nachts aufladen wollen - wenn die Sonne eben nicht scheint. Es ist
schon erstaunlich, mit welcher Anstrengung die friedensbewegte
Solarlobby ans Werk geht, das Volk der Stromverbraucher zu verdummen.
Denn Elektroautos wären ein weiteres Glied in der Kette der
Energiewandlung mit verlustreichen Stromspeichern. Legt man auch
für
diesen Fall einen Wirkungsgrad des Lade- und Entladebetriebes von 70%
zugrunde, dann ergibt sich der Gesamtwirkungsgrad aus den
Stromspeichern am Netz und den Stromspeichern im Automobil von 70% x
70% = 49%. Im Klartext: die Hälfte aller erneuerbarer Energien
würde
erst einmal in Warmluft verwandelt werden. |
|
Fazit: Die vom SFV
angeführten Argumente zum Stromspeichern, z.B. mit Akkumulatoren,
sind ein probates Mittel zur Beförderung der Ineffizienz bei der
Stromerzeugung insgesamt, desgleichen für den effizienten
Ressourcenverbrauch im großen Stil. Zwecks Ankurbelung
wirtschaftlicher Aktivitäten sind solche Argumente durchaus
brauchbar - haben
aber weder mit Ökologie noch mit Klimaschutz - und mit einer
effizienten Energiewende erst recht nichts - zu tun. Sie sind
allenfalls
als
weiteres Geschäftsmodell für eine hochsubventionierte Branche
geeignet.
Aufwändige und
verlustreiche elektrische Energiespeicher  erfüllen
nur dann
einen Sinn, wenn damit noch schlechtere Verhältnisse (Notzeiten)
überbrückt werden können (obiges SFV-Beispiel mit der
Berliner Blockade in der Nachkriegszeit). Neben dem gewaltigen
Aufwand für Ressourcen und Energie für Betrieb und Wartung
sollte auch jener für die spätere Entsorgung nicht vergessen
werden. erfüllen
nur dann
einen Sinn, wenn damit noch schlechtere Verhältnisse (Notzeiten)
überbrückt werden können (obiges SFV-Beispiel mit der
Berliner Blockade in der Nachkriegszeit). Neben dem gewaltigen
Aufwand für Ressourcen und Energie für Betrieb und Wartung
sollte auch jener für die spätere Entsorgung nicht vergessen
werden.
Anders sieht es mit natürlich funktionierenden
Speichersystemen aus. Zum Beispiel mit einem (künstlichen)
Speichersee für die Wasserhaltung:
a) zur Trinkwassersicherung
und
b) zur Kühlwasserbereitstellung (Pegelsteuerung) für ein
Kraftwerk zwecks Sicherstellung der elektrischen Energieversorgung
auch in Trockenzeiten.
Beispielhaft sei hier der Speichersee bei
Geeste/Emsland erwähnt, welcher in das weitverzweigte Fluß-
und
Kanalsystem des Emslandes eingebunden ist. Mit seinem über 23 Mio.
m3
Fassungsvermögen dient er der sicheren
Kühlwasserbereitstellung für das dortige 1.400
MW-Wärmekraftwerk und wurde prinzipiell auch deswegen angelegt. In
Verbindung
mit einer ca. 6 km langen Uferlinie wurden neben einem
ausgedehnten und beliebtem Ausflugs-, Erholungs- und Badeparadies auch
großflächige Flachwasserzonen für den Natur- und
Artenschutz geschaffen. So bietet das
Speicherbecken mit seinen umgebenden und neu
geschaffenen 50 Hektar
Feuchtbiotopen gleichzeitig eine Menge ungestörte Brutzonen und
Lebensraum
für diverse vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten.
Gemäß Infotafel wurden bereits während der Bauphase 115
Hektar Waldflächen mit 750.000 Bäumen auf ehemals
landwirtschaftlich genutzten Flächen für den
Eingriffsausgleich in den Naturraum geschaffen.
Besser für den
Klimaschutz und besser
für Alle: Lieber hektarweite Wasserflächen zum
vielfältigen Nutzen für Menschen, Tiere und Pflanzen als
hektarweite, eintönige, eingezäunte und lebensfeindliche
Solarplattenlandschaften. Der
künstlich geschaffene Speichersee bei Geeste/Emsland bietet neben
seiner technisch-wirtschaftlichen Nutzung als Kühlwasserreservoir
des nahen Wärmekraftwerks ein bedeutsames Potential für die
menschliche Freizeitgestaltung per Radrundfahrt, Windsurfing, Segel-
und Rudersport, Badespaß, einfach am Strand sitzen etc.
gleichfalls die Möglichkeiten einer vielfältigen Naturschutz-
und Lebensraumgestaltung in seinem unmittelbaren Umfeld. Dabei bleibt
auch genügend Wasser für Feuchtbiotope über.
|
Der Webmaster macht ca. 2 Wochen Pause.
|
07.04.2007
|
 Für touristische Rundfahrten auf
dem Genfer See Für touristische Rundfahrten auf
dem Genfer See  darf ein Solarboot (im
Vordergrund) natürlich nicht fehlen. 40 Solarplatten auf dem Dach
sollen dem umweltfreundlichen Antrieb dienen. Tun sie in Wirklichkeit
aber nicht. Elektromotor und Steuerelektronik benötigen zum
Betrieb nämlich eine möglichst lang gleichbleibende und
für jede Fahrsituation stabile Spannung. Die gäbe es nur,
wenn die Sonne mit gleichbleibender Intensität strahlen
würde. Tut sie aber nicht. Der Blick zum Himmel ist
selbsterklärend. Daher ist ein Bootsbetrieb mit geladenen
Akkumulatoren unabdingbar. Bei einem echten, 100%igen Solarbetrieb
würde dies aber in ein Dilemma führen. Entweder laden die
Solarzellen den Akku auf oder die Fahrt geht hinaus auf den See. Beides
gleichzeitig - Akku laden und Fahrgäste transportieren -
dafür ist die zur Verfügung stehende Solarplattenfläche
viel zu klein. Es gibt aber einen Ausweg aus diesem Dilemma.
Während den Liegepausen und des nachts werden per Anschluß
an das Stromnetz von Land die Akkumulatoren geladen. Nur so
läßt sich ein beschränkt bedarfgerechter Betrieb - je
nach touristischem Andrang auf dem Landesteg - befriedigen. Das daneben
liegende dieselgetriebene Schwesterschiff (weiß) ist dagegen
immer einsatzbereit und bewältigt den Massenbetrieb. darf ein Solarboot (im
Vordergrund) natürlich nicht fehlen. 40 Solarplatten auf dem Dach
sollen dem umweltfreundlichen Antrieb dienen. Tun sie in Wirklichkeit
aber nicht. Elektromotor und Steuerelektronik benötigen zum
Betrieb nämlich eine möglichst lang gleichbleibende und
für jede Fahrsituation stabile Spannung. Die gäbe es nur,
wenn die Sonne mit gleichbleibender Intensität strahlen
würde. Tut sie aber nicht. Der Blick zum Himmel ist
selbsterklärend. Daher ist ein Bootsbetrieb mit geladenen
Akkumulatoren unabdingbar. Bei einem echten, 100%igen Solarbetrieb
würde dies aber in ein Dilemma führen. Entweder laden die
Solarzellen den Akku auf oder die Fahrt geht hinaus auf den See. Beides
gleichzeitig - Akku laden und Fahrgäste transportieren -
dafür ist die zur Verfügung stehende Solarplattenfläche
viel zu klein. Es gibt aber einen Ausweg aus diesem Dilemma.
Während den Liegepausen und des nachts werden per Anschluß
an das Stromnetz von Land die Akkumulatoren geladen. Nur so
läßt sich ein beschränkt bedarfgerechter Betrieb - je
nach touristischem Andrang auf dem Landesteg - befriedigen. Das daneben
liegende dieselgetriebene Schwesterschiff (weiß) ist dagegen
immer einsatzbereit und bewältigt den Massenbetrieb.
Um wißbegierigen Solarfreunden zu gefallen, erzählt der
Schiffsführer, daß er zum Ausgleich des von Land bezogenem
Atomstromes für sein Solarboot noch eine netzeinspeisende
Fotovoltaikanlage am Genfer Flughafen betreibt. Klima-ökologisches
Feigenblatt pur - oder?
Auch die Fontäne von Genf
- im Hintergrund - ist für Wind- und Solarstromerzeuger kein
geeignetes Objekt als Stromverbraucher.
 Leserbrief zur ÖKOStrom-Studie bei
Spiegel-online im
Beitrag am 6.4.2007: "Solarfirmen
kassieren Milliarden - auf Kosten der Verbraucher“ von Anselm
Waldermann.
Zitat daraus: “Damit wäre
Solarstrom erstmals günstiger als regulärer Haushaltsstrom,
für den die Verbraucher in Deutschland durchschnittlich 18 Cent
zahlen müssen“. Leserbrief zur ÖKOStrom-Studie bei
Spiegel-online im
Beitrag am 6.4.2007: "Solarfirmen
kassieren Milliarden - auf Kosten der Verbraucher“ von Anselm
Waldermann.
Zitat daraus: “Damit wäre
Solarstrom erstmals günstiger als regulärer Haushaltsstrom,
für den die Verbraucher in Deutschland durchschnittlich 18 Cent
zahlen müssen“.
Leser: Das ist Unsinn, da in den 18
Ct/kWh rd. 7 Ct/kWh staatliche Abgaben und weitere 7 Ct/kWh Kosten
für die Netznutzung enthalten sind. Beide Kostenarten sind aber
von der Stromerzeugungsart ganz unabhängig. Damit verbleiben
für die Stromerzeugungskosten nur 4 Ct/kWh. Aber auch das
wäre als Wirtschaftlichkeitsgrenze unrichtig, weil der Strom aus
Sonnenanlagen nur verfügbar ist, wenn die Sonne scheint. Dies ist
bezogen auf die Nennleistung der Anlage aber nur 800 Stunden im Jahr
der Fall. Das Jahr hat aber 8.760 h in denen Strom benötigt wird.
Dies hat zur Folge, dass nur die Brennstoffkosten in den ohnehin
vorhandenen und für die übrigen rd 8.000 h notwendigen
Kraftwerke ersetzt wird. Die Brennstoffkosten liegen im Mix unter 2
Ct/kWh bei Kernenenergie sogar nur bei 0,3 Ct/kWh. Dass Strom aus
Photovoltaikanlagen jemals unter 2 Ct/kWh produziert werden kann ist
wohl ausgeschlossen, deshalb belasten die Mehrkosten für diese Art
der Stromerzeugung die Strombezieher auf unbegrenzte Zeit für
immer. Helmut Alt
|
06.04.2007
|
 »Die Abhängigkeit von großen
Energieversorgern und
Atomstrom kann jeder einzelne Bürger durchbrechen, indem er sein
eigener Stromproduzent wird«. Diese Behauptung verbreitet
das Magazin der Deutschen Umwelthilfe 1/2007 in seiner Rubrik über
'SolarLokal'. Der Aussage folgt aber kein Hinweis, welchem Bürger
oder welcher Bürgerin in Deutschland dies bisher geglückt
ist. Statt dessen wird der geneigte Leser auf
SolarLokal-Infoblätter verwiesen, welche über die »attraktiven
Vergütungsmöglichkeiten für privat produzierten
Solarstrom« informieren, aber nicht wie man
unabhängig von Atom- oder anderen unliebsamen Strom werden kann.
Zudem könnte angesichts steigender Energiepreise eine private
Solarstromanlage eine lohnende Investition für vorausschauende
Stromverbraucher sein. »Die Abhängigkeit von großen
Energieversorgern und
Atomstrom kann jeder einzelne Bürger durchbrechen, indem er sein
eigener Stromproduzent wird«. Diese Behauptung verbreitet
das Magazin der Deutschen Umwelthilfe 1/2007 in seiner Rubrik über
'SolarLokal'. Der Aussage folgt aber kein Hinweis, welchem Bürger
oder welcher Bürgerin in Deutschland dies bisher geglückt
ist. Statt dessen wird der geneigte Leser auf
SolarLokal-Infoblätter verwiesen, welche über die »attraktiven
Vergütungsmöglichkeiten für privat produzierten
Solarstrom« informieren, aber nicht wie man
unabhängig von Atom- oder anderen unliebsamen Strom werden kann.
Zudem könnte angesichts steigender Energiepreise eine private
Solarstromanlage eine lohnende Investition für vorausschauende
Stromverbraucher sein.
Es ist schon erstaunlich
wie ein renommierter Umweltverband seine Leser mit solch dreisten
Sprüchen verblödet. Aber möglicherweise muß man
sich über ein deratiges Vorgehen garnicht wundern. Denn einer der
beiden Geschäftsführer, Rainer Baake, grüner Politiker
und ehemaliger Staatssekretär im Bundesumweltministerium, hat bei
der DUH seit September 2006 eine neue berufliche Heimat gefunden, dort
wo Klimaschutz, Energiewende und Erhaltung der Biodiversität von
zentraler Bedeutung sind. Blöd an der Sache ist nämlich,
daß Solarstromanlagen das Klima garnicht schützen. Nur wenn
die Sonne tagsüber ausreichend scheint, fließt von privaten
Solarstromanlagen ein bißchen CO2-freier Strom in das Netz, aber
nicht bedarfsgerecht, nachts schon garnicht und in der dunklen
Jahreszeit am wenigsten. Ob nicht bedarfsgerecht erzeugter Strom
überhaupt 'klimaschutzgerecht' fließt, hat bei den
Umweltverbändern noch niemand recherchiert. Denn nicht
bedarfsgerecht ins Netz fließender Strom kann beim Verbraucher
keine Wirkung erzielen, demnach weder das Klima schützen noch eine
Energiewende herbeiführen. Verbraucher sind daher weiterhin
gezwungen, sich auf die konventionelle Stromerzeugung zu verlassen, die
den Strom auch immer dann liefert, wenn er benötigt wird. Wie sich
nun angesichts steigender Energiepreise ein private Solarstromanlage
als lohnende Investition für vorausschauende Stromverbraucher
darstellt, das bleibt im o.g. Beitrag das Geheimnis der DUH.
Schließlich steigt mit steigenden Solarstrommengen im Stromnetz
auch der Strompreis für alle - auch für den
Solarplattenbetreiber - sukzessive an. Damit verringert sich
gleichzeitig die Differenz zwischen der aus dem Netz bezogenen zu der
in das Netz eingespeisten Kilowattstunde und die Investition in die
Solarstromanlage wird stetig unrentabler.
Aufschlußreicher
ist dagegen eine aktuelle Publikation bei SPIEGEL-ONLINE.de. Anhand
einer vom SPIEGEL erläuterten Ökostrom-Studie erfahren wir,
wie Solarfirmen auf Kosten der Verbraucher Milliarden abkassieren.
Gerade einmal ein halbes Prozent sei der Anteil der Sonnenenergie an
der deutschen Stromproduktion. Trotzdem fahren die Solarkonzerne
horrende Gewinne ein und die Zeche würden die Verbraucher zahlen.
Was eine Studie aus der Branche, welche dem SPIEGEL ONLINE vorliegt,
belege.
ÖKOSTROM-STUDIE
Solarfirmen kassieren Milliarden auf Kosten der Verbraucher. Doch allzu
bald würde sich das nicht ändern. Denn gerade erst hätte
das Bundesumweltministerium die geplante Novelle des EEG verschoben.
Bis 2009 müssen sich die Solarkonzerne daher keine Sorge machen.
Sie wissen, unsere Politiker sind für sie da und nicht für
die Verbraucher.
|
05.04.2007
|
 Heute ist nun Gott
sei Dank ein glücklicher Tag! Der Kampf ist vorbei! Der
Regionalverband hat unsern Standort Rot a. d. Rot/ Ellwangen (5
Mega-Windräder) aus der Planung gestrichen und dazu auch noch den
Standort Ehrensberg mit 3 Windrädern. Heute ist nun Gott
sei Dank ein glücklicher Tag! Der Kampf ist vorbei! Der
Regionalverband hat unsern Standort Rot a. d. Rot/ Ellwangen (5
Mega-Windräder) aus der Planung gestrichen und dazu auch noch den
Standort Ehrensberg mit 3 Windrädern.
Ausschlaggebend war
unser avifaunistisches Gutachten für Ellwangen, das den Standort
wg. Milanen, Fledermäusen und Schwarzstörchen etc. als
völlig ungeeignet bezeichnete, und das "vierfach genäht" war,
wie der Verband uns zugestand, nachdem er ein Prüfgutachten
eingeholt hatte - dagegen sei nicht anzuplanen, das sei
wasserdicht.
Hinzu kam insbesondere
für den zweiten geplanten Standort Ehrensberg die Stellungnahme
des Denkmalsamtes beim Regierungspräsidium Tübingen, das
erhebliche Beeinträchtigung der Klosteranlage Ochsenhausen und
umgebender Landschaft anmeldete und strikt gegen die Ausweisung war.
Es sind somit 8
Anlagen gestrichen worden.
Das rettet uns - die 5
Riesendinger hätten 450 m von unserem Einödbauerhof
aufgestellt werden sollen - wir hätten wegziehen und unser Haus
aufgegeben müssen. Neben solchen Windrädern vor der
Haustür würde sich nicht mal mehr der grünste aller
Grünen niederlassen wollen.
Also: Ein großer Erfolg, für uns, unser Dorf
und für unsere ganze oberschwäbische Landschaft! Frank Günther
 Klimawissenschaftler
lügen nicht -
behauptet der Staatssekretär
aus dem Bundesumweltministerium. Politiker lügen auch nicht,
könnte man darauf antworten. Wenn Michael Müller meint,
daß 2.500 Wissenschaftler aus aller Welt an den Berichten des
IPCC gearbeitet hätten, dann sollte er auch sagen, daß die
Endfassung dieser Berichte schließlich von Politikern der
beteiligten Länder und nicht von den Wissenschaftlern
endabgestimmt und zur Publikation freigegeben werden. IPCC ist
schließlich eine politische und keine wissenschaftliche
Organisation. Das erkennt man bereits daran, daß Politiker
bereits vor der Publikation des Klimaberichts dessen 'Fakten' kennen,
welche angeblich den größten Teil der Erwärmung den
menschlichen Aktivitäten zurechnen würden. Leider nennt
Michael Müller kein einziges Argument seiner 'erdrückenden
Fülle von wissenschaftlicher Indizien' samt den 'oftmals
widerlegten Behauptungen', welche in die Irre führen würden.
Er weiß, daß er sofort unwiderlegbar wiederlegt werden
würde. Klimawissenschaftler
lügen nicht -
behauptet der Staatssekretär
aus dem Bundesumweltministerium. Politiker lügen auch nicht,
könnte man darauf antworten. Wenn Michael Müller meint,
daß 2.500 Wissenschaftler aus aller Welt an den Berichten des
IPCC gearbeitet hätten, dann sollte er auch sagen, daß die
Endfassung dieser Berichte schließlich von Politikern der
beteiligten Länder und nicht von den Wissenschaftlern
endabgestimmt und zur Publikation freigegeben werden. IPCC ist
schließlich eine politische und keine wissenschaftliche
Organisation. Das erkennt man bereits daran, daß Politiker
bereits vor der Publikation des Klimaberichts dessen 'Fakten' kennen,
welche angeblich den größten Teil der Erwärmung den
menschlichen Aktivitäten zurechnen würden. Leider nennt
Michael Müller kein einziges Argument seiner 'erdrückenden
Fülle von wissenschaftlicher Indizien' samt den 'oftmals
widerlegten Behauptungen', welche in die Irre führen würden.
Er weiß, daß er sofort unwiderlegbar wiederlegt werden
würde.
|
Müller: “Die Klimawissenschaftler lügen nicht!“
Kritik an irreführenden Äußerungen in den Medien
Der Klimawandel
findet statt, und der Mensch ist wesentlich schuld daran. Das betont
Michael Müller, Parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesumweltministerium, angesichts jüngster Äußerungen
so genannter "Klimaskeptiker“ in unterschiedlichen Medien. "Wer die
wahrscheinlich größte Menschheitsherausforderung der
kommenden Jahrzehnte schlichtweg leugnet, der darf politisch nicht
ernst genommen werden“ appellierte Michael Müller. Vor dem
Hintergrund einer erdrückenden Fülle wissenschaftlicher
Indizien sei es unverantwortlich, wenn man die Öffentlichkeit mit
längst und oftmals widerlegten Behauptungen in die Irre führe.
Es hat fast schon den
Charakter eines Naturgesetzes: Kaum haben Hunderte von Wissenschaftler
aller Disziplinen und aus aller Welt mit aller Nachdrücklichkeit
vor Augen geführt, wie ernst es mit dem Klimawandel ist, schon
tritt der eine oder andere wissenschaftliche Exzentriker hervor und
veröffentlicht einen Leserbrief, in dem er behauptet, dass das
alles nicht wahr sei. Und das Schlimmste: manche Medien schwenken
sofort darauf ein und schreien laut: Alles Lüge mit dem
Klimawandel. Dabei haben rund 2.500 Wissenschaftler aus aller Welt an
den Berichten des internationalen Sachverständigengremiums (IPCC)
mitgearbeitet.
Michael Müller:
"Das ist nur allzu durchsichtig. Unter dem Deckmantel
wissenschaftlicher Meinungsfreiheit werden abstruse Thesen vertreten.“
Etwa die, dass die Sonne am Klimawandel schuld sei, und dass der Mensch
nur ganz wenig zum Klimawandel beitrage. Das IPCC hat vor kurzem das
Gegenteil bewiesen. Es wird die Fakten in der kommenden Woche bei der
Vorstellung des zweiten Teils des Klimaberichts in Brüssel
erhärten. Das Klima wandelt sich bereits heute stärker als in
den letzten 650.000 Jahren, und dies ist zum größten Teil
auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen.
Die heute von
Menschen jährlich emittierte Menge von 22 Milliarden Tonnen
Kohlendioxid ist zwar wenig im Vergleich zum gesamten
Kohlenstoffkreislauf. Doch ist es gerade diese Menge, die das System
aus dem Lot bringt. Niemand leugne den natürlichen Wechsel
zwischen Kalt- und Warmzeiten der Erdgeschichte. Michael Müller:
"Was wir heute aber tun, ist, eine künstliche Warmzeit auf eine
natürliche draufzusatteln.“
BMU Pressedienst Nr. 091/07, 30.03.2007.
|
|
Im heutigen
FAZ-Feuilleton widerlegt z.B. der Paläoklimatologe Augusto Mangini in einem Artikel die IPPC-Behauptung, die jetzt stattfindende
Erwärmung des Klimas wäre nur mit der Erwärmung vor
120.000 Jahren vergleichbar, am Beispiel Trojas. Die
Katastrophenmeldungen zum Klimawandel unserer Tage könnten ebenso
vor 3300 Jahren für die von Homer beschriebene Siedlungsphase VI
geschrieben worden sein. Professor Mangini hatte seine Untersuchungen an
Stalagmiten, er nennt sie "Klima-Archiv“, bereits auf der Klimatagung der Friedrich-Naumann-Stiftung
Februar 2005 in Gummersbach vorgestellt. Klar war dem
Kurvenverlauf über etliche hunderttausende von Jahren zu
entnehmen, daß erst die Erwärmung
einsetzte, ihr mit leichter Verzögerung der CO2-Anstieg folgte -
wohl als Ausgasung aus den Ozeanen.
Zitat: »Die Behauptung, daß die jetzt
stattfindende Erwärmung des Klimas nur mit der Erwärmung vor
120.000 Jahren vergleichbar ist, stimmt einfach nicht. Wir
verfügen über Daten, die zeigen, daß es während
der letzten zehntausend Jahre Perioden gab, die ähnlich warm oder
sogar noch wärmer waren als heute. Ebenso ist es falsch zu
behaupten, daß die jetzige Erwärmung sehr viel schneller
abläuft als frühere Erwärmungen. Tatsache ist, daß
es während der letzten zehntausend Jahre erhebliche globale und
vor allem genauso schnelle Klimawechsel gegeben hat, die die Menschen
sehr stark beeinflußten.« Ausführlicher Text: in der
F.A.Z., 05.04.2007, Nr. 81 / Seite 35
|
29.03.2007
|
THE GREAT GLOBAL
WARMING SWINDLE - Al Gore's movie, "An Inconvenient Truth," has
met its match: a devastating documentary based on sound science by
recording the statements of real climate scientists, says S. Fred
Singer, professor emeritus of environmental sciences at the University
of Virginia and adjunct scholar at the National Center for Policy
Analysis. The scientific arguments presented in, "The Great Global
Warming Swindle," can be stated quite briefly, says Singer:
- Observations in
ice cores show that temperature increases have preceded - not resulted
from - increases in CO2, by hundreds of years, suggesting that the
warming of the oceans is an important source of the rise in atmospheric
CO2.
- As the dominant
greenhouse gas, water vapor is far, far more important than CO2, yet
not well handled by climate models - and, in any case, not within our
control.
- Greenhouse models
also cannot account for the observed cooling of much of the past
century (1940 - 1975), nor for the observed patterns of warming - what
we call the "fingerprints."
|

Natürliche
Veränderungen des Lebensraumes: Eisbären und ihre Beute, die
Robben passen sich an. Zu Eiszeiten wandern
sie weit aufs Meer hinaus.
In Warmzeiten weichen sie an Land zurück.
|
The best evidence we have supports natural causes - part
of a natural cycle of climate warming and cooling that's been traced
back almost a million years -- leaving little we can do about it.
Climate mitigation schemes will not do any good; they are all
irrelevant, useless and wildly expensive, says Singer. Ultimately, we
should not devote our scarce resources to what is essentially a
non-problem, says Singer, while ignoring the real problems the world
faces: hunger, disease and denial of human rights, in favor of
politically fashionable issues.
S. Fred Singer, President - Science &
Environmental Policy Project, Arlington/Virginia, USA
 »Wir müssen zur
Kenntnis nehmen, daß es nach wie vor eine Vielzahl von
Biotopen gibt, die hochgradig gefährdet sind und auch weiter
zurückgehen. Es besteht somit weiterhin kein Grund zur »Wir müssen zur
Kenntnis nehmen, daß es nach wie vor eine Vielzahl von
Biotopen gibt, die hochgradig gefährdet sind und auch weiter
zurückgehen. Es besteht somit weiterhin kein Grund zur
 Entwarnung.
Durch den noch immer viel zu hohen Flächenverbrauch und durch ein
weiteres Voranschreiten der Nutzungsintensität in vielen Bereichen
unserer Kulturlandschaften bei gleichzeitiger Nutzungsaufgabe
traditioneller Bewirtschaftungsformen in vielen Mittelgebirgsregionen
hat sich die Situation insgesamt weiter verschlechtert« - so der
BMU-Pressedienst Nr. 87/07 vom 28.03.2007. Entwarnung.
Durch den noch immer viel zu hohen Flächenverbrauch und durch ein
weiteres Voranschreiten der Nutzungsintensität in vielen Bereichen
unserer Kulturlandschaften bei gleichzeitiger Nutzungsaufgabe
traditioneller Bewirtschaftungsformen in vielen Mittelgebirgsregionen
hat sich die Situation insgesamt weiter verschlechtert« - so der
BMU-Pressedienst Nr. 87/07 vom 28.03.2007.
Abbildung: Anthropogen
veränderter Lebensraum - aber wohl das Biotop des solaren
Zeitalters? Hektarweite, bis zum Horizont reichende Solarplatten als
verbreitetes Beispiel eines gewaltigen Flächenverbrauchs samt
Nutzungaufgabe traditioneller Bewirtschaftungsformen. Für den
Klimaschützer Sigmar Gabriel und für Naturschutzverbände
offenbar der ideale Jagd- und Landeplatz samt Lebensraum für
Vögel, insbesondere für den Turmfalken, Vogel des Jahres
2007?
Weiteres Zitat aus o.g.
BMU-Pressemeldung:
»Die Rote Liste zeigt,
daß die Anstrengungen zum Schutz der Arten- und Lebensraumvielfalt auf allen Ebenen
fortgeführt werden müssen“, so die Bilanz von
Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. Rund 72 Prozent aller 690
verschiedenen Lebensraumtypen in Deutschland gelten nach wie vor als gefährdet
oder sogar als akut von der Vernichtung bedroht. "Der Verlust an
Lebensräumen ist in vielen Fällen nicht oder nur mit
großem Aufwand rückgängig zu machen. Sterben Tier- und Pflanzenarten aus, ist
dies unwiderruflich“, mahnte Gabriel«. Sagen und Tun sind
offenbar in der Politik immer zwei verschiedene Sachen.
|
28.03.2007
|
 Ein herrlicher
Frühlingstag neigt sich dem Ende zu und der Blick in die
Landschaft gibt Gewißheit - kein Lüftchen bewegt sich unter
einem wolkenfreien Himmel und die untergehende Sonne läßt
das Ampèremeter des Solarpanels gegen Null streben. Woher kommt
nun der Strom für den Computer, für den Fernseher, für
die Familienfeier oder tausend andere Dinge und Anwendungen des
täglichen Lebens? Haben Sie zwecks unterbrechungsfreier
Stromversorgung schon ein ausreichend dimensioniertes Biokraftwerk in
Ihrer Nähe? Wer sich aus klimapolitischen Gründen für
die Abschaltung von konventionellen Wärmekraftwerken engagiert,
sollte sich im Gegenzug für einen geeigneten Ersatzstandort samt
Brennstoffversorgung in der Regionalen Raumplanung einbringen - aber
bedenken, daß Biokraftwerke auch nur Wärmekraftwerke sind. Ein herrlicher
Frühlingstag neigt sich dem Ende zu und der Blick in die
Landschaft gibt Gewißheit - kein Lüftchen bewegt sich unter
einem wolkenfreien Himmel und die untergehende Sonne läßt
das Ampèremeter des Solarpanels gegen Null streben. Woher kommt
nun der Strom für den Computer, für den Fernseher, für
die Familienfeier oder tausend andere Dinge und Anwendungen des
täglichen Lebens? Haben Sie zwecks unterbrechungsfreier
Stromversorgung schon ein ausreichend dimensioniertes Biokraftwerk in
Ihrer Nähe? Wer sich aus klimapolitischen Gründen für
die Abschaltung von konventionellen Wärmekraftwerken engagiert,
sollte sich im Gegenzug für einen geeigneten Ersatzstandort samt
Brennstoffversorgung in der Regionalen Raumplanung einbringen - aber
bedenken, daß Biokraftwerke auch nur Wärmekraftwerke sind.
Folgt man der Argumentation des SPD-MdB Dr. Hermann Scheer, in
Zeitungen als 'Fachmann für erneuerbare Energien' tituliert, dann
erzeugen alle derzeit installierten Windräder bei einer mittleren
Anlagengröße von 1 MW rund 7% des deutschen Strombedarfs.
Würde man sie auf 2,5 MW aufrüsten, könnte sich der
Windstromanteil bereits auf 20% erhöhen (Darmstädter Echo vom
27.03.2007). Mit dem Blick aus dem Fenster lassen sich daraus folgende
Schlußfolgerungen ziehen: a) Heute fehlen in Südhessen
mangels Wind bereits 7% des Bedarfs. b). Mit größeren
Windrädern soll der Mangel auf 20% gesteigert werden! Wohl zum
Zweck, damit wir zusätzlich noch möglichst viele
Biomassekraftwerke bauen müssen, welche den künstlich
geschaffenen Mangel kompensieren dürfen.
Und gleich geht die Sonne unter, na ja... gute Nacht Deutschland.
Was das bisher alles kostet, darüber mag die folgende Grafik
informieren. In Bezug auf 1998 hat sich die Gesamtbelastung der
Stromkunden immerhin auf das 5,6fache gesteigert.
Staatlich fixierte
Belastungen aller Stromkunden - Mehrwertsteuer muß noch
hinzugerechnet werden.
Datenquelle: VDEW kritisiert Steuern und Abgaben
(28.03.2007).
|
27.032007
|
 "The Great Global
Warming Swindle“ - eine kritische Auseinandersetzung mit den scheinbar
unumstößlichen Wahrheiten des Weltklimarates, die seit
Anfang Februar den weltweiten Diskurs bestimmen. Immerhin in
Großbritannien sorgte die Produktion für Diskussionen in der
Medienöffentlichkeit. "The Great Global
Warming Swindle“ - eine kritische Auseinandersetzung mit den scheinbar
unumstößlichen Wahrheiten des Weltklimarates, die seit
Anfang Februar den weltweiten Diskurs bestimmen. Immerhin in
Großbritannien sorgte die Produktion für Diskussionen in der
Medienöffentlichkeit.
Ein englischer
Fernsehfilm zeigt die andere Sicht in der Klimadebatte. Es ist eine
kritische Auseinandersetzung mit den Aussagen des Weltklimarates.
Dutzend namhafte Wissenschaftler erzählen über ihre Sicht der
Dinge. Im Internet kann ihn jetzt jeder sehen. WELT online vom
20.03.2007.
Anmerkung: Es gibt einen
weiteren großen Schwindel: wenn Wasserdampffahnen aus
Kraftwerksschloten und Kühltürmen zu CO2-Wolken suggeriert
werden. Offensichtlich sieht die Politik in der Verbreitung von
öffentlichen Lügen, Meinungs- und Wissenschaftsmanipulationen
ihre Existenzgrundlage.
 Klimasünder-Kontrolle
kaum möglich - so
ein Bericht im Spiegel am 21.03.2007. Denn wer natürliche und
industrielle Treibhausgas-Emissionen auseinanderhalten will, muß
erst einmal sagen wir das funktioniert. Es sei alles andere als
einfach. Menschen würden jährlich etwa 25 Milliarden Tonnen
Kohlendioxid ausstoßen, während aus natürlichen Quellen
fast 400 Milliarden Tonnen pro Jahr entstammen. Das sind 6,25% - sofern
diese Zahlen stimmen. Beides meßtechnisch voneinander zu trennen
und so den CO2-Ausstoß einzelner Länder zu erfassen, sei
kaum möglich. ... Klimasünder-Kontrolle
kaum möglich - so
ein Bericht im Spiegel am 21.03.2007. Denn wer natürliche und
industrielle Treibhausgas-Emissionen auseinanderhalten will, muß
erst einmal sagen wir das funktioniert. Es sei alles andere als
einfach. Menschen würden jährlich etwa 25 Milliarden Tonnen
Kohlendioxid ausstoßen, während aus natürlichen Quellen
fast 400 Milliarden Tonnen pro Jahr entstammen. Das sind 6,25% - sofern
diese Zahlen stimmen. Beides meßtechnisch voneinander zu trennen
und so den CO2-Ausstoß einzelner Länder zu erfassen, sei
kaum möglich. ...
Doch solche 'Kleinigkeiten' interessieren unsere Politiker nicht.
Animationen der Treibgasverteilung -
gemessen mit Envisat SCIAMACHY-Daten lassen sich auf der Webseite
der Europäischen Weltraumorganisation ESA betrachten. Aber auch
dieser Bericht zeigt ein Bild mit Wasserdampfwolken aus einem
Kraftwerksschlot, um mittels einer Falsifikation die
Allgemeinheit über den Kohlendioxidausstoß zu verwirren.
Bereits der Begriff 'Treibhausgas' ist eine gezielte Irreführung.
Im Gegensatz zu einem echten Treibhaus mit Dach ist die Erde nach oben
zum Weltraum hin ein offenes System, welches allenfalls lokal und
temporär von Wolken und nicht von Kohlendioxid 'geschlossen'
wird. Doch im Vergleich mit dem unsichtbaren CO2
würden sich mit einem Kampf gegen Wolken am Himmel sämtliche
Politiker und sonstige Protagonisten des Treibhauseffektes
lächerlich machen.
Etwas
aufschlußreicher informiert die englische Webseite
der ESA wie unser Plantet 'atmet' also mit den Treibgasen lebt. Riesige
Mengen des CO2 werden von den Pflanzen während der
Vegetationsphase im Frühjahr und Sommer aufgenommen und in
großen Mengen wieder abgegeben, wenn die Vegetation im Winter
abstirbt und vermodert.
Ein weiteres Beispiel der Dramatisierung der
Erderwärmung zeigt das kleine SPIEGEL-Video: "Das Eis der
Arktis geht zurück". Man bedenke jedoch: schmelzendes
Eis in arktischen Meeren ist zuvor gefrorenes Wasser, vermehrt dieses
beim Auftauen demnach nicht und wird auch nicht zu einem
Meeresspiegelanstieg führen. Ein Glas Wasser mit Eiswürfeln
läuft auch nicht über, nachdem die Eiswürfel getaut
sind. Zu sehen ist mit der Animation das Schrumpfen, aber auch sich
wiederholende Ausdehnungen des akrtischen Meereises. Über eine
damit einhergehende Pegeländerung der Meere wurde dagegen noch
nicht berichtet.
 GOVERNMENT INFLUENCE
ON THE IPCC - I would like to endorse the statement by the Lead
Authors of the IPCC "Summary for Policymakers 2007" as an accurate
account of what happens. It is true that they wrote the document, but
what they do not point out can be seen on the front page of the Report.
They were only "Drafting Authors", not just "Authors". It says that the
document was "formally approved". Yes. by Government Representatives,
and yes, "line-by-line". The scientists' job was to write down what had
been approved by Government Representatives. As such, it was truly a
"consensus" and there is surely little doubt that some Government
Representatives might have wished to see stronger wording than
others. Whatever the scientists, or anybody else likes to
pretend, the whole document is politically controlled to ensure that it
meets the requirements of the Governments that "approve" it. GOVERNMENT INFLUENCE
ON THE IPCC - I would like to endorse the statement by the Lead
Authors of the IPCC "Summary for Policymakers 2007" as an accurate
account of what happens. It is true that they wrote the document, but
what they do not point out can be seen on the front page of the Report.
They were only "Drafting Authors", not just "Authors". It says that the
document was "formally approved". Yes. by Government Representatives,
and yes, "line-by-line". The scientists' job was to write down what had
been approved by Government Representatives. As such, it was truly a
"consensus" and there is surely little doubt that some Government
Representatives might have wished to see stronger wording than
others. Whatever the scientists, or anybody else likes to
pretend, the whole document is politically controlled to ensure that it
meets the requirements of the Governments that "approve" it.
|
25.03.2007
|
 E.ON-Netz plant
Leitungsausbau - Die Folgen
des von Umweltverbänden propagierten sauberen Naturstroms.
Windenergie und neue Kraftwerke brauchen zeitgleichen Netzausbau. Um
sicher zu stellen, daß genügend Transportkanäle
für die erzeugte Energie aus Windkraftanlagen und dem Strommarkt,
das heißt für thermische Kraftwerke und dem Stromhandel zur
Verfügung stehen, muß das Übertragungsnetz ausgebaut
werden. Vor diesem Hintergrund und im Zuge der von der
niedersächsischen Landesregierung geplanten Novelle des
Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen (LROP) beantragt E.ON Netz
daher, die erforderlichen 380 kV-Leitungen ins LROP verbindlich
aufzunehmen. Das zuständige Ministerium für den
ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz hat Erläuterungen zu den Vorhaben und
Planungsunterlagen erhalten. Ziel ist, großräumige Korridore
zu entwickeln, die als Grundlage für die Trassenplanung dienen
sollen. Die rechtsverbindliche Planung erfolgt im späteren
Planfeststellungsverfahren. E.ON-Netz plant
Leitungsausbau - Die Folgen
des von Umweltverbänden propagierten sauberen Naturstroms.
Windenergie und neue Kraftwerke brauchen zeitgleichen Netzausbau. Um
sicher zu stellen, daß genügend Transportkanäle
für die erzeugte Energie aus Windkraftanlagen und dem Strommarkt,
das heißt für thermische Kraftwerke und dem Stromhandel zur
Verfügung stehen, muß das Übertragungsnetz ausgebaut
werden. Vor diesem Hintergrund und im Zuge der von der
niedersächsischen Landesregierung geplanten Novelle des
Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen (LROP) beantragt E.ON Netz
daher, die erforderlichen 380 kV-Leitungen ins LROP verbindlich
aufzunehmen. Das zuständige Ministerium für den
ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz hat Erläuterungen zu den Vorhaben und
Planungsunterlagen erhalten. Ziel ist, großräumige Korridore
zu entwickeln, die als Grundlage für die Trassenplanung dienen
sollen. Die rechtsverbindliche Planung erfolgt im späteren
Planfeststellungsverfahren.
Trassenverlauf Wahle-Mecklar
(Bereich Niedersachsen): Die geplante Trasse verläuft vom
Umspannwerk in Wahle bei Braunschweig bis nach Mecklar in Nordhessen.
Die Länge beträgt rund 190 Kilometer.
Trassenverlauf
Wilhelmshaven-Conneforde: Rund 40 Kilometer erstreckt sich diese
geplante Trasse von den neuen Kraftwerksstandorten in Wilhelmshaven bis
nach Conneforde bei Oldenburg.
Trassenverlauf Diele -
Niederrhein: Die geplante Trasse verläuft vom Umspannwerk
in Diele bei Leer (Ostfriesland) nach Wesel / Niederrhein in
Nordrhein-Westfalen. Sie ist rund 200 Kilometer lang.
http://www.eon-netz.com/
 In Verbindung mit
einem zweiten Offshore-Windpark 14 km nordwestlich von Horns Rev
(Dänemark) müssen neue Hochspannungsleitungen
gebaut werden, um den Windstrom effektiv ins dänische
Versorgungsnetz einspeisen zu können. ehr bei http://www.nordschleswiger.dk/SEEEMS/129.asp?artid=7345
vom 21.02.2007. In Verbindung mit
einem zweiten Offshore-Windpark 14 km nordwestlich von Horns Rev
(Dänemark) müssen neue Hochspannungsleitungen
gebaut werden, um den Windstrom effektiv ins dänische
Versorgungsnetz einspeisen zu können. ehr bei http://www.nordschleswiger.dk/SEEEMS/129.asp?artid=7345
vom 21.02.2007.
 Bürgerinitiativen
in Nordwest-Mecklenburg und Ludwigslust machen sich gegen eine
geplante 380 Kilovolt-Leitung stark. Bürgerinitiativen
in Nordwest-Mecklenburg und Ludwigslust machen sich gegen eine
geplante 380 Kilovolt-Leitung stark.
Gemeinden unter
Hochspannung
»Die Planer
wohnen ja nicht hier", steht auf einem Plakat in der Gemeinde Klein
Rogahn (Landkreis Ludwigslust). Daneben ein Bild eines stilisierten
Hochspannungsmastes, dessen Leitung genau über einem gemalten
Häuschen verläuft. So fühlen sich die Einwohner von
Orten in den Kreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust, in deren
Region der Energie-Konzern Vattenfall eine Hochspannungsleitung bauen
will. Die rund 70 Kilometer lange und 70 Meter breite Trasse mit
ihren 150 Stahlmasten, jeder rund 60 Meter hoch, werde die Landschaft
zerschneiden, formuliert der Bürgermeister der Gemeinde Klein
Rogahn, Michael Vollmerich (parteilos), die Ablehnung der Bürger.
Rund 450 Meter von den Häusern... «.
 Eon-Plan für
neue 380.000-Volt-Überlandleitung sorgt für Wirbel in
Gemeinden Northeim. Mächtig sind die Strommasten, die in einigen
Jahren im Kreis Northeim für die 380 000-Volt-Hochspannungstrasse
zwischen Wahle bei Braunschweig und Mecklar bei Bad Hersfeld errichtet
werden sollen. Und teils mächtig ist auch bereits der Widerstand,
der sich kreisweit in den Städten und Gemeinden gegen das Projekt
der Eon-Netz GmbH formiert. Eon-Plan für
neue 380.000-Volt-Überlandleitung sorgt für Wirbel in
Gemeinden Northeim. Mächtig sind die Strommasten, die in einigen
Jahren im Kreis Northeim für die 380 000-Volt-Hochspannungstrasse
zwischen Wahle bei Braunschweig und Mecklar bei Bad Hersfeld errichtet
werden sollen. Und teils mächtig ist auch bereits der Widerstand,
der sich kreisweit in den Städten und Gemeinden gegen das Projekt
der Eon-Netz GmbH formiert.
Furcht vor
Riesenmasten
50 Meter hoch, das ist etwa die anderthalbfache Höhe
des Northeimer Kreishauses (siehe Grafik rechts), sollen die
Stahlmasten sein. Die Masten sollen im Abstand von 300 bis 500 Metern
aufgestellt werden. Die Traversen sind 30 Meter lang. ...
 Der Bund für
Umwelt und Naturschutz (BUND) hat den geplanten Bau einer
Hochspannungsleitung durch Westmecklenburg kritisiert. Die
380-Kilovolt-Leitung von Schwerin nach Hamburg werde die Landschaft
"zerschneiden" sowie Vogelzuglinien und Vogelrastgebiete
beeinträchtigen, teilte der BUND in Schwerin mit. Die
Umweltschutzorganisation forderte die Verlegung von Erdkabeln, was das
Unternehmen Vattenfall Europe Transmission aber aus Kostengründen
ablehne. Die Umweltschützer wollen am nächsten Donnerstag in
Groß Rogahn bei Schwerin über die ökologischen Folgen
der Hochspannungsleitung informieren. Die Leitung sollte
ursprünglich bis Ende des Jahres gebaut werden. Vattenfall Europe
Transmission betonte, dass die sogenannte Windsammelschiene vor allem
zum Transport der an der Küste erzeugten Windenergie in die
Ballungszentren dienen soll. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz sind
die Übertragungsnetzbetreiber dazu verpflichtet, Windenergie
vorrangig abzunehmen und bundesweit zu transportieren. Schwerin/Hamburg
(dpa) 04.02.2007 Der Bund für
Umwelt und Naturschutz (BUND) hat den geplanten Bau einer
Hochspannungsleitung durch Westmecklenburg kritisiert. Die
380-Kilovolt-Leitung von Schwerin nach Hamburg werde die Landschaft
"zerschneiden" sowie Vogelzuglinien und Vogelrastgebiete
beeinträchtigen, teilte der BUND in Schwerin mit. Die
Umweltschutzorganisation forderte die Verlegung von Erdkabeln, was das
Unternehmen Vattenfall Europe Transmission aber aus Kostengründen
ablehne. Die Umweltschützer wollen am nächsten Donnerstag in
Groß Rogahn bei Schwerin über die ökologischen Folgen
der Hochspannungsleitung informieren. Die Leitung sollte
ursprünglich bis Ende des Jahres gebaut werden. Vattenfall Europe
Transmission betonte, dass die sogenannte Windsammelschiene vor allem
zum Transport der an der Küste erzeugten Windenergie in die
Ballungszentren dienen soll. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz sind
die Übertragungsnetzbetreiber dazu verpflichtet, Windenergie
vorrangig abzunehmen und bundesweit zu transportieren. Schwerin/Hamburg
(dpa) 04.02.2007
 Wie nötig ist
die 380 kV-Leitung über den Thüringer Wald? Seit die Pläne des Energieriesen
Vattenfall konkret geworden sind, ist in den Südthüringer
Tälern der Teufel los. Die Strombrücke, über Land mit
bis zu hundert Meter hohen Masten auf einer Schneise von 120 Meter
Breite, ruft in allen betroffenen Gemeinden Bürgerinitiativen auf
den Plan. Der Umweltschutz, die schöne Landschaft, die eigene
Gesundheit und die Touristen - alles sei dann weg. ... Wie nötig ist
die 380 kV-Leitung über den Thüringer Wald? Seit die Pläne des Energieriesen
Vattenfall konkret geworden sind, ist in den Südthüringer
Tälern der Teufel los. Die Strombrücke, über Land mit
bis zu hundert Meter hohen Masten auf einer Schneise von 120 Meter
Breite, ruft in allen betroffenen Gemeinden Bürgerinitiativen auf
den Plan. Der Umweltschutz, die schöne Landschaft, die eigene
Gesundheit und die Touristen - alles sei dann weg. ...
Tiefer Einschnitt in
intakte Kulturlandschaft
Nach dem Streit über die
Windkraftanlagen folgt der Ärger über den dafür
notwendigen Trassenbau. 380 kV-Erdverkabelung nicht weniger
störend als eine Freileitung. Hochspannung unter der Erde
würde einen 60 Meter breiten Streifen bedeuten, der immer
schneefrei bleibt.... Verlauf durch 20 Schutzgebiete ...
Ostthüringer Zeitung vom 03.03.2007
|
22.03.2007
|
 Wie man Verwaltungen
effizient beschäftigt, das verstehen unsere Politiker wohl
am
besten. Was geschieht eigentlich mit den sogenannten 'Kleinen
Anfragen', welche unsere Parlamentarier in Massen an die Regierung
richten? In Wahrnehmung ihrer Kontrollfunktion können sie die
Regierung auffordern, zu bestimmten Sachverhalten eine Stellungnahme
abzugeben. Ohne sich über die Effizienz ihrer eigenen
Tätigkeit Gedanken zu machen, verlangen sie Auskunft über
jene der anderen. Hier über Fortschritte zur Energieeffizienz in
einem Zeitraum von
1990 bis 2020, also über 30 Jahren. Doch statt konkrete
Vorschläge zu machen, wie und mit welchen Mitteln und
Maßnahmen und in welchen Bereichen unseres Lebens die
Energieeffizienz zu tragfähigen Umweltbedingungen zu verbessern
sei, fordern sie von der Regierung eine lineare Steigerung von
jährlich drei Prozent der Energieproduktivität -
jährlich drei Prozent weniger Aufwand für das jeweils gleiche
Ergebnis. Linear betrachtet und auf die parlamentarische Verwaltung
bezogen würde diese im Ergebnis nach 33,3 Jahren ohne irgend einen
Aufwand arbeiten und trotzdem die volle Leistung bringen. Ein Aberwitz,
welcher beweist, daß unsere Politiker im allgemeinen garnicht
wissen, worüber sie palavern. Eine lineare Steigerung der
Energieeffizienz auf ihren theoretischen Höchstwert = 100% (ein
Perpetuum mobile) gibt es nicht. Eine steigende Näherung dahin hat
keinen linearen, sondern den Kurvenverlauf einer Asymptote - einer
Kurve, welche sich einer Geraden (z.B. der x-Achse) stetig nähert,
doch ohne sie jemals zu berühren oder zu schneiden. Auf die Praxis
bezogen bedeutet dies, daß sich mit jeder weiteren
Annäherung der Effizienz an hundert Prozent deren weitere
Verbesserung überporportional erschwert. Wie man Verwaltungen
effizient beschäftigt, das verstehen unsere Politiker wohl
am
besten. Was geschieht eigentlich mit den sogenannten 'Kleinen
Anfragen', welche unsere Parlamentarier in Massen an die Regierung
richten? In Wahrnehmung ihrer Kontrollfunktion können sie die
Regierung auffordern, zu bestimmten Sachverhalten eine Stellungnahme
abzugeben. Ohne sich über die Effizienz ihrer eigenen
Tätigkeit Gedanken zu machen, verlangen sie Auskunft über
jene der anderen. Hier über Fortschritte zur Energieeffizienz in
einem Zeitraum von
1990 bis 2020, also über 30 Jahren. Doch statt konkrete
Vorschläge zu machen, wie und mit welchen Mitteln und
Maßnahmen und in welchen Bereichen unseres Lebens die
Energieeffizienz zu tragfähigen Umweltbedingungen zu verbessern
sei, fordern sie von der Regierung eine lineare Steigerung von
jährlich drei Prozent der Energieproduktivität -
jährlich drei Prozent weniger Aufwand für das jeweils gleiche
Ergebnis. Linear betrachtet und auf die parlamentarische Verwaltung
bezogen würde diese im Ergebnis nach 33,3 Jahren ohne irgend einen
Aufwand arbeiten und trotzdem die volle Leistung bringen. Ein Aberwitz,
welcher beweist, daß unsere Politiker im allgemeinen garnicht
wissen, worüber sie palavern. Eine lineare Steigerung der
Energieeffizienz auf ihren theoretischen Höchstwert = 100% (ein
Perpetuum mobile) gibt es nicht. Eine steigende Näherung dahin hat
keinen linearen, sondern den Kurvenverlauf einer Asymptote - einer
Kurve, welche sich einer Geraden (z.B. der x-Achse) stetig nähert,
doch ohne sie jemals zu berühren oder zu schneiden. Auf die Praxis
bezogen bedeutet dies, daß sich mit jeder weiteren
Annäherung der Effizienz an hundert Prozent deren weitere
Verbesserung überporportional erschwert.
Nirgends ist
ersichtlich, wo grüne Politiker eine praktische Maßnahme
umgesetzt haben, mit der sie sich beispielhaft und fortschrittlich
präsentieren und damit die Regierung vor sich hertreiben
könnten. Eine stete Mahnung an andere, es doch besser als bisher
zu machen, erscheint geradezu lächerlich und wirkt
abstoßend. Die Folge: immer mehr Bürgerinnen und Bürger
denken über die Effizienz von allgemeinen Wahlen nach, welche
zunehmend unter die 30%-Marke rutscht.
Hier stellt sich die
Frage nach einer Verbesserung der Effizienz von 'Kleinen Anfragen'.
Welchen Nutzen hat die Allgemeinheit davon, wenn eine Opposition
mittels Antwort auf 'Kleine Anfragen' üblicherweise von der
Regierung öffentlich mitgeteilt bekommt, was sie sowieso zu tun
gedenkt?
|
|
Grüne erkundigen sich nach
Verbesserung der Energieeffizienz
Berlin: (hib/VOM) Wie die Bundesregierung die
Energieeffizienz verbessern will, interessiert Bündnis 90/Die
Grünen in einer Kleinen Anfrage (16/4655). Die Bundesregierung
habe sich zum Ziel gesetzt, die Energieproduktivität bis 2020 im
Vergleich zu 1990 zu verdoppeln. Die bisherigen Fortschritte reichten
nicht aus, so die Fraktion. Zuletzt sei die Steigerung der
Energieproduktivität auf unter ein Prozent jährlich gesunken.
Um das Ziel zu erreichen, sei aber eine jährliche Steigerung von
drei Prozent erforderlich. Die Regierung soll sagen, wie Deutschland im
internationalen Vergleich bei der Energieproduktivität dasteht,
wie die vorhandenen Potenziale ausgeschöpft werden können und
wie die Effizienz von Elektrogeräten verbessert werden kann. Unter
anderem soll die Regierung zu dem Vorschlag Stellung nehmen, den
Stromverbrauch von Elektrogeräten im Standby-Modus auf maximal ein
Watt pro Gerät zu begrenzen. Auch die Effizienzanreize durch die
Stromsteuer soll sie beziffern. Ferner wird gefragt, was die Regierung
unternimmt, um die Energieeffizienz in Gebäuden zu verbessern und
welche Wirkungen sie sich vom geplanten Energiegebäudepass
verspricht.
|
|
Effizienter Umgang mit
Energie und Rohstoffen
würde sich zu einer Schlüsselfrage des 21. Jahrhunderts
entwickeln und wir würden nicht allein aus
ökologischen
Gründen mehr Ressourceneffizienz benötigen.
Dieser in der folgenden BMU-Mitteilung getroffenen Aussage ist durchaus
zuzustimmen. Aber wie vereinbaren sich das Sagen und Tun mit der
hiesigen Politik? Wer sich in deutschen Landen gezielt umschaut, kann
von der geforderten Ressourceneffizienz allenfalls das per
Erneuerbare-Energien-Gesetz fixierte und proklamierte Gegenteil
vorfinden. Woran läßt sich z.B. die Ressourceneffizienz bei
den über 20.000 gewaltigen Windrädern erkennen, welche
bezogen auf ihre geringfügige Auslastung und auf den von ihnen
produzierten Strom Eisen, Kupfer, Aluminium und andere knappe und teure
Ressourcen in einem Umfang verbrauchen, wie er zuvor nicht bekannt war?
Bei welchen Produktionen lassen sich diese hauptsächlich
benötigten Metalle durch elektrischen Strom aus Windenergie
ersetzten? Und können hektarweite Solaranlagen mit ihrem
bißchen Tagesstrom den für sie benötigten gewaltigen
Materialaufwand ausgleichen? Welche Solarzellenfabrik arbeitet
eigentlich völlig autark mit reinem Sonnenstrom aus ihrer eigenen
Photovoltaikanlage - Tag und Nacht? Und mit welcher
sich selber gesetzten Ressourceneffizienz-Vorgabe ist das neue vom
Bundesumweltministerium
gegründete 'Netzwerk Ressourceneffizienz' angetreten?
|
|
Gabriel:
Deutschland kann Weltmeister bei der Ressourceneffizienz werden
Neues Netzwerk
verknüpft Wirtschaft, Forschung und Politik
In Berlin ist heute das "Netzwerk
Ressourceneffizienz“ gegründet
worden. Die vom Bundesumweltministerium gestartete Initiative soll das
Know-how zum sparsameren Umgang mit Energie und Rohstoffen bündeln
und die Kommunikation zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
intensivieren.
"Das Netzwerk ist ein wichtiges Element unserer ökologischen
Industriepolitik. Denn der effiziente Umgang mit Energie und Rohstoffen
entwickelt sich zu einer Schlüsselfrage des 21. Jahrhunderts. Wir
brauchen mehr Ressourceneffizienz nicht allein aus ökologischen
Gründen. Die Weltmarktpreise für importierte Rohstoffe sind
im Euro-Raum zwischen den Jahren 2000 und 2005 um 81 Prozent gestiegen.
Langfristig werden nur solche Volkswirtschaften ökonomisch
erfolgreich sein können, die auf massive Effizienzsteigerungen
setzen. Deutschland hat die große Chance, bis zum Jahr 2020 zur
ressourceneffizientesten Volkswirtschaft der Welt zu werden“, sagte
Bundesumweltminister Sigmar Gabriel bei der Auftaktkonferenz.
Das "Netzwerk
Ressourceneffizienz“ soll Unternehmen, Ingenieure, Entwickler,
Forscher, Wissenschaftler, Ausbilder, Verbände und andere
Multiplikatoren wie Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen
verknüpfen. Die branchenübergreifende Plattform wird
Informationen über relevante Technologien und wissenschaftliche
Erkenntnisse sammeln und verbreiten. Außerdem sollen Studien und
Pilotvorhaben zu ausgewählten Fragestellungen entwickelt und auf
den Weg gebracht werden.
BMU Pressedienst Nr. 070/07 vom 12.03.2007
|
|
 Dem eleganten
Jäger fehlt es zunehmend an Nistmöglichkeiten und
Lebensraum - teilt uns der Naturschutzbund NABU auf seiner Webseite
mit. Gemeint ist der Turmfalke, Vogel des Jahres 2007. Wenn er
rüttelnd über einer Wiese steht, weiß auch der Laie,
das ist der Turmfalke, so der Vogelschutzverein. Doch Wiesen und freie
Brachflächen werden in unserem Land zunehmend von hektarweiten und
spiegelnden Solarplatten sowie Monokulturen für die 'biologische'
Energiegewinnung abgedeckt. Ob ein in der Luft rüttelnder oder auf
dem nächsten Baum ansitzender Turmfalke da noch Mäuse und
anderes Kleingetier finden kann? Was tut der NABU dagegen? Auf seiner
Webseite wird man zu 'nature-rings.de'
verwiesen, um sich dort gegen eine Spende Vogel- und Tierstimmen
für das Handy aus dem Internt runterladen zu können. Von der
Alpendohle bis zum Wolf etc.! Danke lieber NABU für die
ausgesprochen praktische Gewissenserleichterung. Dem eleganten
Jäger fehlt es zunehmend an Nistmöglichkeiten und
Lebensraum - teilt uns der Naturschutzbund NABU auf seiner Webseite
mit. Gemeint ist der Turmfalke, Vogel des Jahres 2007. Wenn er
rüttelnd über einer Wiese steht, weiß auch der Laie,
das ist der Turmfalke, so der Vogelschutzverein. Doch Wiesen und freie
Brachflächen werden in unserem Land zunehmend von hektarweiten und
spiegelnden Solarplatten sowie Monokulturen für die 'biologische'
Energiegewinnung abgedeckt. Ob ein in der Luft rüttelnder oder auf
dem nächsten Baum ansitzender Turmfalke da noch Mäuse und
anderes Kleingetier finden kann? Was tut der NABU dagegen? Auf seiner
Webseite wird man zu 'nature-rings.de'
verwiesen, um sich dort gegen eine Spende Vogel- und Tierstimmen
für das Handy aus dem Internt runterladen zu können. Von der
Alpendohle bis zum Wolf etc.! Danke lieber NABU für die
ausgesprochen praktische Gewissenserleichterung.
Wenig schmeichelhaft, doch konkret sieht ein langjähriger
Beobachter der Vogelschutzszene die gegenwärtige Entwickling
aufgrund einer NABU-Studie über naturfeindliche Windkraftwerke.
Artenvernichtung deutlicher
eingestanden
sagt er. »Jetzt, wo es zu spät ist, ringt sich der
offizielle NABU als größter deutscher "Naturschutzverband"
offensichtlich auf Druck der unzufriedenen Basis dazu durch, die bisher
stets heruntergespielte, sogar abgestrittene Umwelt- und
Naturfeindlichkeit von Windkraftwerken deutlicher einzugestehen. Eine
neue NABU-Studie zur "Auswirkung von Windrädern
auf Vögel und Fledermäuse" ... «.
|
18.03.2007
|
 Miserable
Auslastung der riesigen Klimaschutzmaschinen. Weht der Wind oder
weht er nicht? Miserable
Auslastung der riesigen Klimaschutzmaschinen. Weht der Wind oder
weht er nicht? 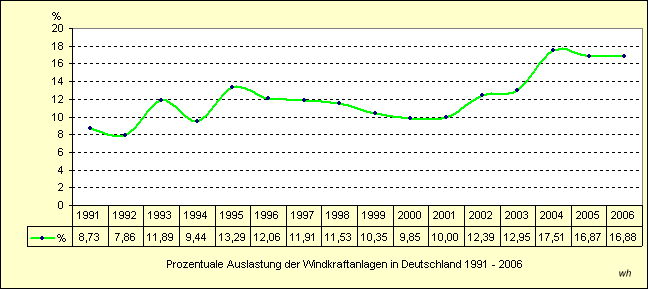 Das
ist für Stromhändler nicht nur eine kurzfristig
interessierende Frage für den jeweils folgenden Handelstag an der
Strombörse sondern auch eine für WKA-Betreiber aus
längerer Sicht übers Jahr. Die mittlere Windstärke eines
Jahres, abhängig von der Großwetterlage und den lokalen
Standortbedingungen, bestimmt die elektrische Auslastung der
High-Tech-Riesenmaschinen in 100 m Höhe und mehr, somit auch den
monetären Ertrag. Das
ist für Stromhändler nicht nur eine kurzfristig
interessierende Frage für den jeweils folgenden Handelstag an der
Strombörse sondern auch eine für WKA-Betreiber aus
längerer Sicht übers Jahr. Die mittlere Windstärke eines
Jahres, abhängig von der Großwetterlage und den lokalen
Standortbedingungen, bestimmt die elektrische Auslastung der
High-Tech-Riesenmaschinen in 100 m Höhe und mehr, somit auch den
monetären Ertrag.
Weil es seit Anfang an klar ist, daß Betreiber oder Investoren
mit EE-Anlagen für Sonne und Wind keine Renditen auf dem freien
Markt erzielen werden, mußte für sie ein staatliches
Reglement geschaffen werden - das Erneuerbare- Energien-Gesetz. Es
verpflichtet einfach die Stromverbraucher zu einer kostendeckenden
Vergütung an die Betreiber für den elektrischen Strom, den
sie garnicht bestellen und trotzdem ins Haus geliefert bekommen.
Was taugt diese Form der Stromgewinnung mit Windkraftanlagen
eigentlich? Die Antwort darauf sollte sich an dem Bedürfnis der
Stromnutzer orientieren. Die wollen ihn zu jeder Zeit in einer jeweils
ausreichenden Menge haben. Windkraftanlagen können diesen Wunsch
nicht erfüllen - der Wind weht unregelmäßig. Daher
müssen sie in das herkömmliche System integriert werden, in
dem sie lediglich als additive Stromerzeuger, keineswegs als
alternative fungieren können. Windkraftanlagen kommen hinzu und
nicht anstatt konventionelle Kraftwerke und daher auch deren auf alle
Endkunden umzulegende Stromkosten. Und läßt sich mit der
schlechten Auslastung dieser riesigen Klimaschutzmaschinen
überhaupt das Klima schützen? Darüber gibt es leider
keine Statistiken.
Die nebenstehende Grafik
verrät etwas über den wirtschaftlichen Nutzen dieser vom Wind
abhängigen Stromerzeuger - nämlich deren Auslastung über
das Produktionsjahr gesehen. Die hat seit Beginn der Windstromerzeugung
- bezogen auf alle deutschen Windanlagen - 18% nicht
überschritten, wie dem grünen Linienverlauf zu entnehmen ist.
Die Auslastung eines Produktionsbetriebes ist stets ein wichtiges
Maß für dessen Existenz und Fortbestehen samt seinen
Arbeitsplätzen. Geht die Auslastung von Produktionsbetrieben auf
70% und weniger runter, dann sind im allgemeinen
Betriebsschließungen und schmerzhafte Sanierungsmaßnahmen
angesagt. Das gilt keineswegs für die größten
Stromerzeuger aller Zeiten, die Windkraftanlagen. Deren
Subventionierung ist so hoch angelegt, daß sie sich für
Betreiber auch wirklich rentieren. Auf das gesamte
Stromversorgungssysten wirken sie dagegen äußerst
unwirtschaftlich. Der Auslastungsmittelwert über all die Jahre
1991 bis 2006
beträgt 12,1%. Für den 'Klimaschutz' dürften sie genau
so unwirtschaftlich arbeiten wie für die Stromerzeugung.
Beitrag der
Windräder zur Stromerzeugung in Deutschland 1991 - 2006
Datenquelle: Arbeitsgruppe Erneuerbare
Energien-Statistik (AGEE-Stat) und Bundesverband Windenergie BWE
|
17.03.2007
|
 Alles öko oder
watt? Für die 100
Prozent-Öko-Gläubigen in Ostfriesland verkauft die Naturwatt
GmbH, ein Ableger des Oldenburger Stromversorgers EWE, auch 100%
CO2-freien, klimafreundlichen und wertvollen Strom plus aus
erneuerbaren Energien. Gegenüber dem herkömmlich erzeugten
EWE Strom classic kostet er nur zwei Euro/Monat mehr. Nun konnte man
gestern im ostfriesischen Anzeiger für das Harlinger Land eine
Meldung der IHK für Ostfriesland und Papenburg lesen, wonach alle
Stromkunden im Kammerbezirk bereits mit 74% reiner Öko-Energie aus
Windkraftanlagen versorgt werden und der Nordwesten Deutschlands das
EU-Klimaschutzziel für 2020 von 20% bereits seit 1998 erfüllt
habe. Da müssen doch Leute, welche sich auf so einen Deal
einlassen, einen tiefen Glauben an ein mit CO2 geschürtes
Höllenklima haben, wenn sie meinen, für die restlichen 26%
Reinheitsgrade regelmäßig Ablaßscheine kaufen zu
müssen. Oder ein fürchterlich schlechtes Öko-Gewissen,
welches sie nachts nicht mehr schlafen läßt. Aber wie schon
zu Johannes Tetzel's Zeiten im ausgehenden Mittelalter (zu Beginn der
Kleinen Eiszeit - der damaligen Klimakatastrophe) können sich
heute solche Geschäfte nur die etwas besser verdienenden
Grünen und Ökologisten leisten. Alles öko oder
watt? Für die 100
Prozent-Öko-Gläubigen in Ostfriesland verkauft die Naturwatt
GmbH, ein Ableger des Oldenburger Stromversorgers EWE, auch 100%
CO2-freien, klimafreundlichen und wertvollen Strom plus aus
erneuerbaren Energien. Gegenüber dem herkömmlich erzeugten
EWE Strom classic kostet er nur zwei Euro/Monat mehr. Nun konnte man
gestern im ostfriesischen Anzeiger für das Harlinger Land eine
Meldung der IHK für Ostfriesland und Papenburg lesen, wonach alle
Stromkunden im Kammerbezirk bereits mit 74% reiner Öko-Energie aus
Windkraftanlagen versorgt werden und der Nordwesten Deutschlands das
EU-Klimaschutzziel für 2020 von 20% bereits seit 1998 erfüllt
habe. Da müssen doch Leute, welche sich auf so einen Deal
einlassen, einen tiefen Glauben an ein mit CO2 geschürtes
Höllenklima haben, wenn sie meinen, für die restlichen 26%
Reinheitsgrade regelmäßig Ablaßscheine kaufen zu
müssen. Oder ein fürchterlich schlechtes Öko-Gewissen,
welches sie nachts nicht mehr schlafen läßt. Aber wie schon
zu Johannes Tetzel's Zeiten im ausgehenden Mittelalter (zu Beginn der
Kleinen Eiszeit - der damaligen Klimakatastrophe) können sich
heute solche Geschäfte nur die etwas besser verdienenden
Grünen und Ökologisten leisten.
 Während der
Mittelalterlichen Warmzeit lagen die
Durchschnittstemperaturen ca. 1,5 °C höher als heute. Dieses
'Mittelalterliche Klimaoptimum' war eine vom 9. bis in das 14.
Jahrhundert andauernde Periode eines mit heute vergleichsweise milden
Klimas. Das Packeis im nördlichen Atlantik zog sich nach Norden
zurück und ermöglichte den Wikingern die Besiedelung von
Island und Grönland und erlaubte ihnen sogar die Viehzucht in den
heute wieder vereisten Landschaften. Eigentlich keine
überraschende Neuigkeit, steht in (fast) jedem Lexikon.
Überraschend ist eigentlich die gegenwärtige Angst vor einer
mit milderen Temperaturen begründete Klimakatastrophe. Ob die
nordischen Länder das damals auch als katastrophal empfunden haben
und auf CO2-Reduktionen drängten. Viel schlimmer dürfte es
sie bis hin nach Grönland getroffen haben, als der
mittelalterlichen Warmzeit die 'Kleine Eiszeit' folgte, welche bis in
die Gegenwart anhält. Menschliche Hochkulturen haben sich in
Warmzeiten und nicht während Eiszeiten entwickelt. Ebenso die
Tier- und Pflanzenwelt. Die kann sich offensichtlich schneller als homo
sapiens an ein sich veränderndes Klima anpassen. Kommt der
Frühling einmal früher, dann blüht und kreucht es auch
früher, desgleichen auch umgekehrt. Während der
Mittelalterlichen Warmzeit lagen die
Durchschnittstemperaturen ca. 1,5 °C höher als heute. Dieses
'Mittelalterliche Klimaoptimum' war eine vom 9. bis in das 14.
Jahrhundert andauernde Periode eines mit heute vergleichsweise milden
Klimas. Das Packeis im nördlichen Atlantik zog sich nach Norden
zurück und ermöglichte den Wikingern die Besiedelung von
Island und Grönland und erlaubte ihnen sogar die Viehzucht in den
heute wieder vereisten Landschaften. Eigentlich keine
überraschende Neuigkeit, steht in (fast) jedem Lexikon.
Überraschend ist eigentlich die gegenwärtige Angst vor einer
mit milderen Temperaturen begründete Klimakatastrophe. Ob die
nordischen Länder das damals auch als katastrophal empfunden haben
und auf CO2-Reduktionen drängten. Viel schlimmer dürfte es
sie bis hin nach Grönland getroffen haben, als der
mittelalterlichen Warmzeit die 'Kleine Eiszeit' folgte, welche bis in
die Gegenwart anhält. Menschliche Hochkulturen haben sich in
Warmzeiten und nicht während Eiszeiten entwickelt. Ebenso die
Tier- und Pflanzenwelt. Die kann sich offensichtlich schneller als homo
sapiens an ein sich veränderndes Klima anpassen. Kommt der
Frühling einmal früher, dann blüht und kreucht es auch
früher, desgleichen auch umgekehrt.
Damit bloß keine
unkontrollierte globale
Temperaturveränderung stattfindet, schickt sich die Politik an,
per CO2-Klimamodelle einen globalen Raumthermostaten zu installieren,
um dessen richtige Einstellung und Beherrschung sich ein erbitterter
wissenschaftlicher und politischer Streit entfacht hat. Dazu wurde das
Bild eines geschlossenen Treibhauses mit gleichbleibender Temperatur
geschaffen, welche per Thermostat ständig konstant gehalten werden
muß. Das Schlimme ist, daß sich viele Wissenschaftler dabei
auf die Ebene der Politik begeben, astrologische Vorausschauen
abliefern und so das Nest einer begründeten Wissenschaft mit
nachvollziehbaren Argumenten beschmutzen. Und Politiker behalten bei
auftretenden Wetterextremen immer Recht, egal ob es nun wärmer
oder kälter wird - Schuld daran hat der CO2-bedingte Klimawandel.
Wie ungewisse
Klimamodelle mit ungewissen Wirtschaftsmodellen
verknüpft 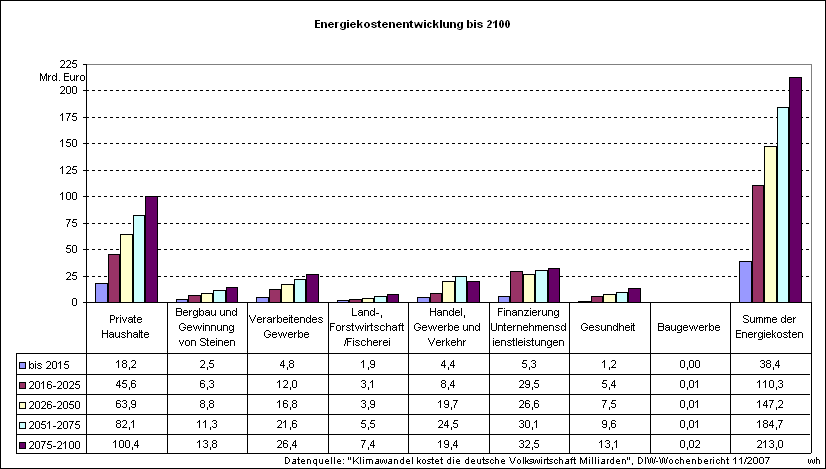 und daraus Schlußfolgerungen bis zum
Jahr 2100
gezogen werden, beweist ein neuer Beitrag von Claudia Kemfert im
Wochenbericht 11/2007 des Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) mit dem aufreißerischen Titel
"Klimawandel kostet die deutsche Volkswirtschaft Milliarden". Die darin
publizierten Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Globale
Erwärmung bringt offenbar nur Nachteile und keine Vorteile.
Nachvollziehbare Begründungen, weshalb in dem Bericht ohne
Bilanzierung der Vor- und Nachteile einer Klimaerwärmung
gearbeitet wird, bzw., falls dies doch irgendwie geschehen ist, weshalb
sämtliche Ergebnisse nur in eine steigende Kostenentwicklung
(nebenstehende Grafik) zeigen, werden nicht geliefert. Einzig die
Bauwirtschaft scheint von der Klimakatastrophe unbeeinflußt zu
bleiben. Obwohl doch auch sie z.B. von der teuren CO2-Reglementierung
über den Nationalen Allokationsplan (NAP) betroffen ist. Als eine
der negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den Wirtschaftszweig
'Energie' muß z.B. das äußerst abstruse Argument einer
durch Wasserknappheit bedingten unzureichenden Kühlwasserzufuhr
für konventionelle bzw. Kernkraftwerke herhalten. Da sollte man
halt wissen, daß auch riesige Solarstromanlagen bei hohen
Temperaturen deutlich an Effizienz verlieren bzw. für eine
unveränderte Stromlieferung mit Wasser gekühlt werden
müssen und es daher besser wäre, gleich darauf zu verzichten,
statt deren Ausbau stark und kostenträchtig zu erhöhen. und daraus Schlußfolgerungen bis zum
Jahr 2100
gezogen werden, beweist ein neuer Beitrag von Claudia Kemfert im
Wochenbericht 11/2007 des Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) mit dem aufreißerischen Titel
"Klimawandel kostet die deutsche Volkswirtschaft Milliarden". Die darin
publizierten Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Globale
Erwärmung bringt offenbar nur Nachteile und keine Vorteile.
Nachvollziehbare Begründungen, weshalb in dem Bericht ohne
Bilanzierung der Vor- und Nachteile einer Klimaerwärmung
gearbeitet wird, bzw., falls dies doch irgendwie geschehen ist, weshalb
sämtliche Ergebnisse nur in eine steigende Kostenentwicklung
(nebenstehende Grafik) zeigen, werden nicht geliefert. Einzig die
Bauwirtschaft scheint von der Klimakatastrophe unbeeinflußt zu
bleiben. Obwohl doch auch sie z.B. von der teuren CO2-Reglementierung
über den Nationalen Allokationsplan (NAP) betroffen ist. Als eine
der negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den Wirtschaftszweig
'Energie' muß z.B. das äußerst abstruse Argument einer
durch Wasserknappheit bedingten unzureichenden Kühlwasserzufuhr
für konventionelle bzw. Kernkraftwerke herhalten. Da sollte man
halt wissen, daß auch riesige Solarstromanlagen bei hohen
Temperaturen deutlich an Effizienz verlieren bzw. für eine
unveränderte Stromlieferung mit Wasser gekühlt werden
müssen und es daher besser wäre, gleich darauf zu verzichten,
statt deren Ausbau stark und kostenträchtig zu erhöhen.
Zur Grafik: Private
Haushalte, bzw. das gemeine Volk werden die
Entwicklung der Energiekosten zu schultern haben.
Weshalb von allen in
dieser Studie modellierten Disziplinen die
negative Kostenentwicklung am stärksten für die privaten
Haushalte ausfällt, wird nicht konkret erläutert,
läßt sich aber spekulieren, bzw. aus dem vorletzten Satz der
Studie herleiten: »Der Ausbau erneuerbarer Energien in Europa
soll stark erhöht, die Energieimporte reduziert, die
Anbieterländer diversifiziert und die Ausgestaltung des
europäischen Emissionshandels verbessert werden«. Nun, mit
dem unverdächtigen Begriff 'private Haushalte' darf sich
schließlich jeder Otto Normalverbraucher angesprochen und
betroffen fühlen. Daher sind die undefinierten 'privaten
Haushalte' schon immer vorzüglich für eine ideologisch
gesteuerte Hirnwäsche - hier für die Gefahren durch den
Klimawandel - geeignet, zwecks Erlangung einer politisch
gewünschten Zahlungsbereitschaft.
 Vom 15. bis
17.03.2007 treffen sich die G8-Umweltminister in Potsdam,
um über das globale Klima zu reden. Dabei soll auch die vom
Klimawandel betroffene Artenvielfalt zur Sprache kommen, denn
nächstes Jahr wird in Bonn die Vertragsstaatenkonferenz zum Schutz
der Biodiversität stattfinden. Beim Weltgipfel in Johannesburg im
Jahr 2000 hatten sie einst vereinbart, bis 2010 den Verlust an
Artenvielfalt zu stoppen. Über den durch den Klimawandel bedingten
Verlust an biologischer Vielfalt weiß natürlich der WWF zu
klagen. Für ihn sind Klimawandel und Artensterben unmittelbar
miteinander verknüpft. Schlußfolgernd wäre der
'Klimakiller' CO2 auch gleichzeitig ein 'Artenkiller', gültig
für Flora und Fauna. Zunehmend wird jedoch unübersehbar, wie
alle, welche sich am lautesten zu Wort melden, doch nur vom Klimawandel
profitieren wollen. Motto: Dabeisein und Mitreden ist alles. Und
für den NABU-Präsidenten Olaf Tschimpke ist ein weltweiter
technologischer Wettlauf um die besten Konzepte und Technologien zur
drastischen Senkung des Energieverbrauchs, zur Verbesserung der
Energieeffizienz sowie zum Ausbau der erneuerbaren Energien das Gebot
der Stunde. Gegen weniger und effizientere Energienutzung gibt es
keinen vernünftigen Einwand, weshalb aber der Ausbau der
regenerativen Energien dem Artenschutz dienen soll, ist unbegreiflich.
Wo doch die Gewinnung dieser Energieform mit dem größten
Flächenverbrauch aller Zeiten samt Bodenzerstörung
einhergeht. Ob der NABU erklären kann, wie z.B. ein Turmfalke und
andere Vögel über einer hektarweiten Solarplattenfläche
ihre Nahrung und Lebensräume finden sollen? Wenn das EU-Ziel mit
20% Anteil erneuerbare Energien umgesetzt werden soll, werden wir bald
quadratkilometerweise Monokulturen mit 'Energiepflanzen' vorfinden. Ob
das der biologischen Vielfalt - der Datenbank der Natur - dient, darf
bezweifelt werden. Vom 15. bis
17.03.2007 treffen sich die G8-Umweltminister in Potsdam,
um über das globale Klima zu reden. Dabei soll auch die vom
Klimawandel betroffene Artenvielfalt zur Sprache kommen, denn
nächstes Jahr wird in Bonn die Vertragsstaatenkonferenz zum Schutz
der Biodiversität stattfinden. Beim Weltgipfel in Johannesburg im
Jahr 2000 hatten sie einst vereinbart, bis 2010 den Verlust an
Artenvielfalt zu stoppen. Über den durch den Klimawandel bedingten
Verlust an biologischer Vielfalt weiß natürlich der WWF zu
klagen. Für ihn sind Klimawandel und Artensterben unmittelbar
miteinander verknüpft. Schlußfolgernd wäre der
'Klimakiller' CO2 auch gleichzeitig ein 'Artenkiller', gültig
für Flora und Fauna. Zunehmend wird jedoch unübersehbar, wie
alle, welche sich am lautesten zu Wort melden, doch nur vom Klimawandel
profitieren wollen. Motto: Dabeisein und Mitreden ist alles. Und
für den NABU-Präsidenten Olaf Tschimpke ist ein weltweiter
technologischer Wettlauf um die besten Konzepte und Technologien zur
drastischen Senkung des Energieverbrauchs, zur Verbesserung der
Energieeffizienz sowie zum Ausbau der erneuerbaren Energien das Gebot
der Stunde. Gegen weniger und effizientere Energienutzung gibt es
keinen vernünftigen Einwand, weshalb aber der Ausbau der
regenerativen Energien dem Artenschutz dienen soll, ist unbegreiflich.
Wo doch die Gewinnung dieser Energieform mit dem größten
Flächenverbrauch aller Zeiten samt Bodenzerstörung
einhergeht. Ob der NABU erklären kann, wie z.B. ein Turmfalke und
andere Vögel über einer hektarweiten Solarplattenfläche
ihre Nahrung und Lebensräume finden sollen? Wenn das EU-Ziel mit
20% Anteil erneuerbare Energien umgesetzt werden soll, werden wir bald
quadratkilometerweise Monokulturen mit 'Energiepflanzen' vorfinden. Ob
das der biologischen Vielfalt - der Datenbank der Natur - dient, darf
bezweifelt werden.
|
16.03.2007
|
 Die erneuerbaren
Energien beschäftigen mittlerweile rund 214.000
Menschen - läßt uns Bundesumweltminister Gabriel
(SPD) per BMU-Pressemitteilung Nr. 055/07 vom 27.02.2007
wissen. Und sein Gesinnungsfreund Hans-Josef Fell von den Grünen
verbreitet in den Nürnberger Nachrichten vom 16.03.2007 folgende
Weisheit: Für erneuerbare Energien spreche u.a. das Argument, bis
2020 Hundertausende Arbeitsplätze zu schaffen. Von einem
Atomstromer hätte er dagegen noch nie von einem
Arbeitsplatzangebot gehört. Die erneuerbaren
Energien beschäftigen mittlerweile rund 214.000
Menschen - läßt uns Bundesumweltminister Gabriel
(SPD) per BMU-Pressemitteilung Nr. 055/07 vom 27.02.2007
wissen. Und sein Gesinnungsfreund Hans-Josef Fell von den Grünen
verbreitet in den Nürnberger Nachrichten vom 16.03.2007 folgende
Weisheit: Für erneuerbare Energien spreche u.a. das Argument, bis
2020 Hundertausende Arbeitsplätze zu schaffen. Von einem
Atomstromer hätte er dagegen noch nie von einem
Arbeitsplatzangebot gehört.
Derart gewichtige Argumente lassen sich gegenüber der
Allgemeinheit, insbesondere gegenüber dem bundesdeutschen Heer von
Arbeitslosen wohl kaum widerlegen. Aber sollte man das? Wäre es
nicht besser, das Modell des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EGG) auch
auf andere Branchen auszudehnen? Zum Beispiel auf das Zeitungswesen.
Die Leser bekommen zwar - wie beim Strom - immer die gleiche Zeitung,
müssen aber mit ihrem Kauf oder dem Abo eine Zwangsabgabe
entrichten, welche dazu dient, immer mehr Verlagshäuser samt deren
Beschäftigte zu finanzieren, welche stets für das selbe
Produkt tätig sind. Und mit dem zunehmend betriebenen Aufwand
steigt die jährliche Zwangsabgabe, vornehm als kostendeckende
Vergütung deklariert. Ein Arbeitsplatzknüller ohnegleichen!
Und wie das EEG ein weiterer Exportschlager! Für unsere Politik
ist das die Effizienzrevolution.
Ob diese Methode der Arbeitsplatzbeschaffung auch volkwirtschaftlich
Sinn macht? Auf den elektrischen Strom bezogen bedeutet es, daß
der Aufwand für das Produkt Kilowattstunde mit der Anzahl der
dafür Beschäftigten stetig zunimmt und der Endverbraucher
für die stets gleiche Ware ebenso stetig mehr bezahlen muß.
Auf die Spitze getrieben führt dies letztlich dazu, daß
Endkunden bei gleichbleibendem oder gar abnehmendem Stromverbrauch
schließlich nur noch die Arbeitsplätze in der EE-Branche
bezahlen und nicht mehr den Strom. Und Hans-Josef Fell prahlt sogar -
bis 2020 könnten es Hunderttausende sein. Dabei spottet der
grüne Politiker noch über die Kernenergiebranche, welche
nicht so verfahre, was ja schließlich auch auf die anderen
herkömmlichen Stromversorger zutrifft.
Grundsätzlich handelt jedes wirtschaftlich arbeitende Unternehmen
unter Effizienzaspekten, worunter herkömmliche
Wirtschaftstheoretiker den geringsten, rationalen Mitteleinsatz im
Herstellungsprozeß bzw. in einem Erzeugungssystem zwecks
Erzielung eines maximalen Produktionsergebnisses verstehen. Dazu
gehören auch möglichst wenig Arbeitsplätze. Diese
müssen nicht im Erzeugungsprozeß, sondern im
vielfältigen Anwendungsprozeß eines preiswerten Produktes -
hier beim elektrischen Strom - entstehen. Doch unsere alternativen
Wirtschaftstheoretiker in der Politik stellen den Begriff Effizienz
einfach auf den Kopf und kluge Zeitungsschreiber verbreiten deren dumme
Sprüche kommentarlos weiter. Der Eindruck von einer
Gesinnungspresse liegt nahe. Doch diese Form der Arbeitsbeschaffung im
Erzeugungsprozeß ist nichts neues. Wir kennen sie aus der
Bürokratie, welche immer wieder neue Gesetze und Verordnungen
erzeugt, so ihre eigene Existenz ausweitet und ihr Produkt
Dienstleistung zunehmend verteuert.
|
15.03.2007
|
|
 Mit Windkraftanlagen
erzeugen wir elektrischen Strom, um das Klima zu schützen -
aber nicht, um dem Verbraucher zu nützen. Die allgemeine
Volksverblödung scheint keine Grenzen zu kennen. Auch nicht bei
der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland. Die in der
dortigen Region aufgestellten Windpropeller mit einer Spitzenleistung
bei Starkwind von 846 MW hätten sich mit 1.570 Mio.
Kilowattstunden = 74% am Stromverbrauch beteiligt, demnach auch an
jenem der Kammer. Diese Menge liegt somit bei 370% über dem
EU-Klimaziel für 2020. Toll! Aber woher kommt der Strom bei
Flaute? Am besten von schnell reagierenden Gaskraftwerken. Deren
Brennstoff ist von den herkömmlichen bei der Stromerzeugung
bekanntlich der teuerste. Das scheint für die IHK wohl ohne
Interesse zu sein. Und was der Strom erst kosten wird, wenn noch viel
mehr Klimaschutzstrom auf offener See produziert und mit
mächtigen Leitungstrassen ins Binnenland transportiert werden
muß? Nun, dann werden die belämmerten Endverbraucher in
ihrem ostfriesischen Anzeiger lesen dürfen, daß sie das
Klimaziel für 2020 um 500% oder noch mehr übertroffen haben.
Vielleicht sind es einst 1.000%. Ob sie dafür einen ebensoviel
besseren Strom als die Bayern und Hessen kriegen? Danke, liebe IHK
für die Aufklärung! Vielleicht denken Sie einmal an den 4.
November 2006 zurück, als es auf technischer Seite der Windstrom
war, welcher in Ihrem Bezirk den Anstoß für einen
europaweiten Blackout gab. Ganz offensichtlich muß es wohl erst
recht ordentlich weh tun, bis man selbst bei der IHK bemerkt, daß
ein 'klimafreundlicher' Strom nicht unbedingt ein
verbraucherfreundlicher Strom ist. Mit Windkraftanlagen
erzeugen wir elektrischen Strom, um das Klima zu schützen -
aber nicht, um dem Verbraucher zu nützen. Die allgemeine
Volksverblödung scheint keine Grenzen zu kennen. Auch nicht bei
der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland. Die in der
dortigen Region aufgestellten Windpropeller mit einer Spitzenleistung
bei Starkwind von 846 MW hätten sich mit 1.570 Mio.
Kilowattstunden = 74% am Stromverbrauch beteiligt, demnach auch an
jenem der Kammer. Diese Menge liegt somit bei 370% über dem
EU-Klimaziel für 2020. Toll! Aber woher kommt der Strom bei
Flaute? Am besten von schnell reagierenden Gaskraftwerken. Deren
Brennstoff ist von den herkömmlichen bei der Stromerzeugung
bekanntlich der teuerste. Das scheint für die IHK wohl ohne
Interesse zu sein. Und was der Strom erst kosten wird, wenn noch viel
mehr Klimaschutzstrom auf offener See produziert und mit
mächtigen Leitungstrassen ins Binnenland transportiert werden
muß? Nun, dann werden die belämmerten Endverbraucher in
ihrem ostfriesischen Anzeiger lesen dürfen, daß sie das
Klimaziel für 2020 um 500% oder noch mehr übertroffen haben.
Vielleicht sind es einst 1.000%. Ob sie dafür einen ebensoviel
besseren Strom als die Bayern und Hessen kriegen? Danke, liebe IHK
für die Aufklärung! Vielleicht denken Sie einmal an den 4.
November 2006 zurück, als es auf technischer Seite der Windstrom
war, welcher in Ihrem Bezirk den Anstoß für einen
europaweiten Blackout gab. Ganz offensichtlich muß es wohl erst
recht ordentlich weh tun, bis man selbst bei der IHK bemerkt, daß
ein 'klimafreundlicher' Strom nicht unbedingt ein
verbraucherfreundlicher Strom ist.
|
|
Anzeiger
für Harlingerland-online, für 16. März 2007
Klimaziel übertroffen
Im Nordwesten boomt Windenergie
Ostfriesland/ah – Wesentliche Ziele des
EU-Klima-Gipfels sind im Bezirk der Industrie- und Handelskammer
für Ostfriesland und Papenburg
(IHK) längst erfüllt. Allein im vergangenen Jahr seien in
dieser
Region insgesamt 1.570 Millionen Kilowattstunden aus Windkraft erzeugt
worden, schreibt die Kammer in einer Pressemitteilung. Das entspricht
einem Anteil von 74 Prozent (2005: 63 Prozent) der tatsächlich
verbrauchten Strommenge in Ostfriesland und Papenburg. "Der Anteil der
regenerativen Energien soll laut EU-Gipfel bis 2020 insgesamt 20
Prozent betragen. Dieses Ziel hat der Nordwesten bereits 1998 erstmals
erfüllt“,
erklärt IHK-Geschäftsführer Dr. Jan Amelsbarg. Zum
Jahresende waren im IHK-Bezirk 866 Windenergieanlagen mit einer
Gesamtleistung von 846 MW
in Betrieb. Gegenüber dem Vorjahr ist somit die Leistung um 6,5
Prozent, die Zahl der Windenergieanlagen um drei Prozent gestiegen. Die
Möglichkeiten für neue Windparks, erläutert Amelsbarg
weiter, seien naturgemäß irgendwann erschöpft.
Insbesondere in
Küstennähe seien gute Standorte nur begrenzt verfügbar.
Die Anstrengungen, die planungs-
und genehmigungsrechtliche Stolpersteine beim so genannten "Repowering“
aus dem Weg zu räumen, sollten deshalb intensiviert werden.
Weitere Zukunftsentwicklungen ergeben sich nach Ansicht der IHK aus den
geplanten Offshoreparks. |
|
 Elektromagnetische
Abweiser könnten Fledermäuse vor dem Tod durch die
Kollision mit Windrädern bewahren. Das ist das Ergebnis einer
Studie schottischer Wissenschaftler, die demnächst in der Public
Library of Science One erscheint. Windräder sind eine große
Bedrohung für Fledermäuse, in Österreich ist vor allem
der Große Abendsegler betroffen. Elektromagnetische
Abweiser könnten Fledermäuse vor dem Tod durch die
Kollision mit Windrädern bewahren. Das ist das Ergebnis einer
Studie schottischer Wissenschaftler, die demnächst in der Public
Library of Science One erscheint. Windräder sind eine große
Bedrohung für Fledermäuse, in Österreich ist vor allem
der Große Abendsegler betroffen.
Blocker soll
Windrad-Falle für Fledermäuse entschärfen
Windkraftanlagen:
Experte fordert Berücksichtigung der Fledermaus-Routen - so der
Bericht von pressetext.de. Seltsame Ansichten von Experten, kann man da
nur sagen. Die beste Berücksichtigung für Fledermäuse
ist die Vermeidung von Gefahren. Wirkungsvoller als mit der Vermeidung
von CO2, wäre die Vermeidung von Windkraftanlagen, deren
Klimaschutzfunktion bisher nur behauptet, aber in keiner Weise
verifiziert wurde. Erkennbar wird dagegen, daß mit angeblichen
Techniken für den Fledermausschutz plötzlich die steigenden
Gefahren für Fledermäuse zugegeben werden. Einem englischen
Bericht zufolge handelt es sich bei den Blockern um Radarstrahler.
|
|

|
Es gibt noch viele
vorangegangene Informationen
|
Anfragen
und weitere
Informationen bei:
|
Dies ist eine
private Webseite copy
but right! - Keine Haftung für die Inhalte fremder Seiten,
welche mit dieser verknüpft sind.
Die
Seite für den
GEGENWIND - fachlich, informativ,
kompetent, unabhängig, nicht kommerziell, nicht gesponsort
|
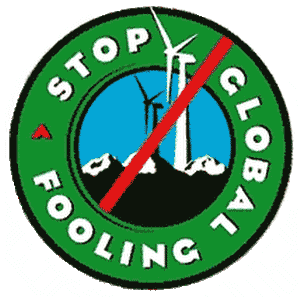



 erfüllen
nur dann
einen Sinn, wenn damit noch schlechtere Verhältnisse (Notzeiten)
überbrückt werden können (obiges SFV-Beispiel mit der
Berliner Blockade in der Nachkriegszeit). Neben dem gewaltigen
Aufwand für Ressourcen und Energie für Betrieb und Wartung
sollte auch jener für die spätere Entsorgung nicht vergessen
werden.
erfüllen
nur dann
einen Sinn, wenn damit noch schlechtere Verhältnisse (Notzeiten)
überbrückt werden können (obiges SFV-Beispiel mit der
Berliner Blockade in der Nachkriegszeit). Neben dem gewaltigen
Aufwand für Ressourcen und Energie für Betrieb und Wartung
sollte auch jener für die spätere Entsorgung nicht vergessen
werden. 

 Entwarnung.
Durch den noch immer viel zu hohen Flächenverbrauch und durch ein
weiteres Voranschreiten der Nutzungsintensität in vielen Bereichen
unserer Kulturlandschaften bei gleichzeitiger Nutzungsaufgabe
traditioneller Bewirtschaftungsformen in vielen Mittelgebirgsregionen
hat sich die Situation insgesamt weiter verschlechtert« - so der
BMU-Pressedienst Nr. 87/07 vom 28.03.2007.
Entwarnung.
Durch den noch immer viel zu hohen Flächenverbrauch und durch ein
weiteres Voranschreiten der Nutzungsintensität in vielen Bereichen
unserer Kulturlandschaften bei gleichzeitiger Nutzungsaufgabe
traditioneller Bewirtschaftungsformen in vielen Mittelgebirgsregionen
hat sich die Situation insgesamt weiter verschlechtert« - so der
BMU-Pressedienst Nr. 87/07 vom 28.03.2007. 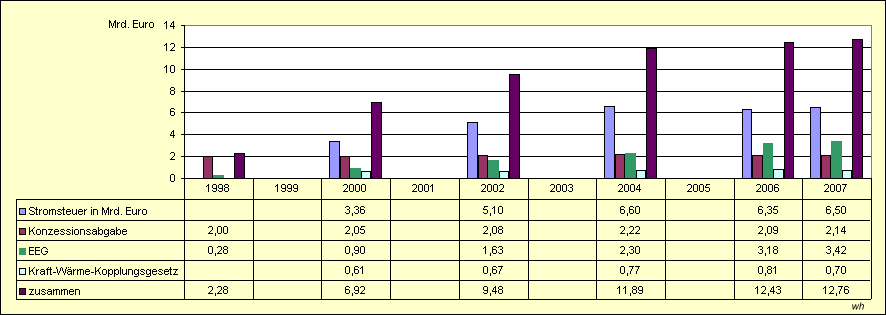
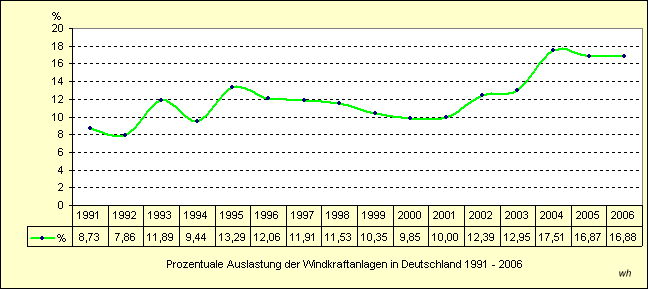 Das
ist für Stromhändler nicht nur eine kurzfristig
interessierende Frage für den jeweils folgenden Handelstag an der
Strombörse sondern auch eine für WKA-Betreiber aus
längerer Sicht übers Jahr. Die mittlere Windstärke eines
Jahres, abhängig von der Großwetterlage und den lokalen
Standortbedingungen, bestimmt die elektrische Auslastung der
High-Tech-Riesenmaschinen in 100 m Höhe und mehr, somit auch den
monetären Ertrag.
Das
ist für Stromhändler nicht nur eine kurzfristig
interessierende Frage für den jeweils folgenden Handelstag an der
Strombörse sondern auch eine für WKA-Betreiber aus
längerer Sicht übers Jahr. Die mittlere Windstärke eines
Jahres, abhängig von der Großwetterlage und den lokalen
Standortbedingungen, bestimmt die elektrische Auslastung der
High-Tech-Riesenmaschinen in 100 m Höhe und mehr, somit auch den
monetären Ertrag. 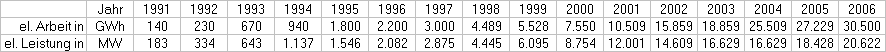
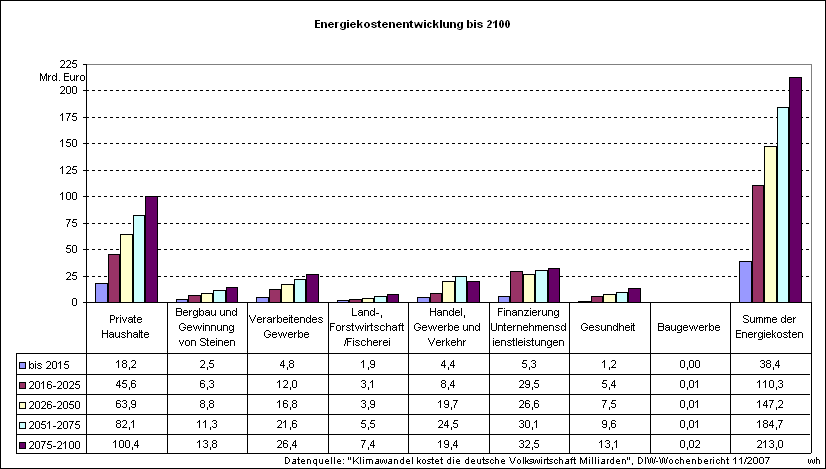 und daraus Schlußfolgerungen bis zum
Jahr 2100
gezogen werden, beweist ein neuer Beitrag von Claudia Kemfert im
Wochenbericht 11/2007 des Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) mit dem aufreißerischen Titel
"Klimawandel kostet die deutsche Volkswirtschaft Milliarden". Die darin
publizierten Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Globale
Erwärmung bringt offenbar nur Nachteile und keine Vorteile.
Nachvollziehbare Begründungen, weshalb in dem Bericht ohne
Bilanzierung der Vor- und Nachteile einer Klimaerwärmung
gearbeitet wird, bzw., falls dies doch irgendwie geschehen ist, weshalb
sämtliche Ergebnisse nur in eine steigende Kostenentwicklung
(nebenstehende Grafik) zeigen, werden nicht geliefert. Einzig die
Bauwirtschaft scheint von der Klimakatastrophe unbeeinflußt zu
bleiben. Obwohl doch auch sie z.B. von der teuren CO2-Reglementierung
über den Nationalen Allokationsplan (NAP) betroffen ist. Als eine
der negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den Wirtschaftszweig
'Energie' muß z.B. das äußerst abstruse Argument einer
durch Wasserknappheit bedingten unzureichenden Kühlwasserzufuhr
für konventionelle bzw. Kernkraftwerke herhalten. Da sollte man
halt wissen, daß auch riesige Solarstromanlagen bei hohen
Temperaturen deutlich an Effizienz verlieren bzw. für eine
unveränderte Stromlieferung mit Wasser gekühlt werden
müssen und es daher besser wäre, gleich darauf zu verzichten,
statt deren Ausbau stark und kostenträchtig zu erhöhen.
und daraus Schlußfolgerungen bis zum
Jahr 2100
gezogen werden, beweist ein neuer Beitrag von Claudia Kemfert im
Wochenbericht 11/2007 des Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) mit dem aufreißerischen Titel
"Klimawandel kostet die deutsche Volkswirtschaft Milliarden". Die darin
publizierten Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Globale
Erwärmung bringt offenbar nur Nachteile und keine Vorteile.
Nachvollziehbare Begründungen, weshalb in dem Bericht ohne
Bilanzierung der Vor- und Nachteile einer Klimaerwärmung
gearbeitet wird, bzw., falls dies doch irgendwie geschehen ist, weshalb
sämtliche Ergebnisse nur in eine steigende Kostenentwicklung
(nebenstehende Grafik) zeigen, werden nicht geliefert. Einzig die
Bauwirtschaft scheint von der Klimakatastrophe unbeeinflußt zu
bleiben. Obwohl doch auch sie z.B. von der teuren CO2-Reglementierung
über den Nationalen Allokationsplan (NAP) betroffen ist. Als eine
der negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den Wirtschaftszweig
'Energie' muß z.B. das äußerst abstruse Argument einer
durch Wasserknappheit bedingten unzureichenden Kühlwasserzufuhr
für konventionelle bzw. Kernkraftwerke herhalten. Da sollte man
halt wissen, daß auch riesige Solarstromanlagen bei hohen
Temperaturen deutlich an Effizienz verlieren bzw. für eine
unveränderte Stromlieferung mit Wasser gekühlt werden
müssen und es daher besser wäre, gleich darauf zu verzichten,
statt deren Ausbau stark und kostenträchtig zu erhöhen.